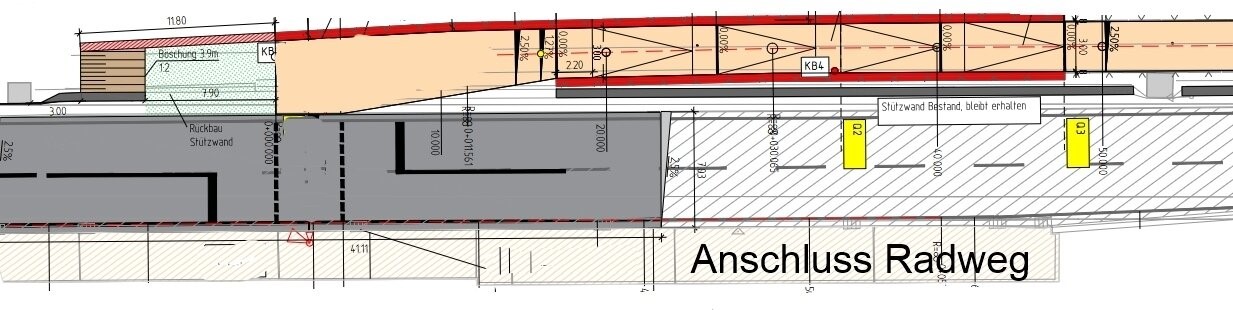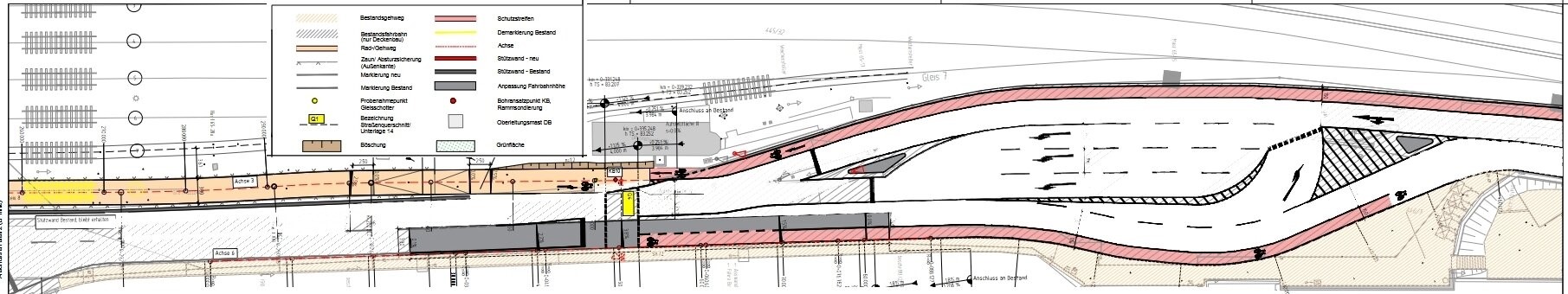von Thomas Ax
Versucht ein Auftraggeber in einem EUweiten Vergabeverfahren über Bauleistungen entgegen § 8aEU VOB/A anstatt der VOB/B ein weitgehend abweichendes vertragliches Regelwerk zur Anwendung zu bringen, kann der Verstoß gegen § 8aEU VOB/A im Vergabenachprüfungsverfahren geltend gemacht werden da es sich (auch) um eine vergaberechtliche Norm handelt.
Eine zivilrechtliche Prüfung von Vertragsklauseln in Form einer AGB-Inhaltskontrolle findet im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren nicht statt.
Gem. § 8aEU Abs. 1 VOB/A ist in den Vergabeunterlagen vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Nach § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 1 VOB/A müssen die Regelungen der VOB/B grundsätzlich unverändert bleiben. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass durch die abweichenden Vereinbarungen der Parteien ein Eingriff in die Regelungen der VOB/B vorgenommen wird und auf diese Weise die VOB/B ihre Privilegierung als Allgemeine Geschäftsbedingung verliert.
Von diesem Grundsatz sind folgende Ausnahmen möglich: Gem. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 2 VOB/A können Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, die Regelungen der VOB/B für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen. Diese Zusätzlichen Vertragsbedingungen dürfen den Regelungen der VOB/B gem. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A allerdings nicht widersprechen. Ferner können nach § 8aEU Abs. 2 Nr. 2 VOB/A die Regelungen der VOB/B durch Besondere Vertragsbedingungen ergänzt werden, wobei sich Abweichungen auf die Fälle beschränken sollen, in denen in der VOB/B eine besondere Vereinbarung ausdrücklich vorgesehen ist und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 13).
Zusätzliche Vertragsbedingungen werden regelmäßig als Allgemeine Geschäftsbedingungen gem. § 305 Abs. 1 BGB einzustufen sein, mit der Konsequenz, dass die einzelnen Regelungen der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB unterfallen, falls keine Privilegierung durch die Vereinbarung der VOB/B als Ganzes eingreift (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 16).
Zusätzliche Vertragsbedingungen dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB/B gem. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A jedoch nicht widersprechen, sondern die Regelungen der VOB/B allenfalls konkretisieren oder näher ausgestalten. Eine Konkretisierung der Regelungen der VOB/B kommt beispielsweise dort in Betracht, wo die VOB/B unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet. Für nähere Ausgestaltungen ist insbesondere dort Raum, wo die Regelungen der VOB/B eine gesonderte Abrede zwischen den Parteien voraussetzen. Dies ist z.B. der Fall bei Regelungen zu Ausführungsfristen, die nach § 5 Abs. 1 VOB/B einer Vereinbarung zwischen den Parteien bedürfen oder bei einer Vertragsstrafe gem. § 11 VOB/B.
Eine Konkretisierung bzw. Ausgestaltung der VOB/B kommt auch dort in Betracht, wo die Regelungen der VOB/B sogenannte Öffnungsklauseln („wenn nichts anderes vereinbart ist“) enthalten (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 17-20).
Vgl dazu VK Südbayern, 14.02.2022 – 3194.Z3-3_01-21-44:
Gründe
I.
1
Mit Auftragsbekanntmachung vom 15.06.2021 schrieb die Antragsgegnerin den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit Wohnnutzung aus. Einziges Zuschlagskriterium war der Preis. Das Leistungsverzeichnis enthielt unter Abschnitt B – Bauvertrag umfassende Regelungen und Vertragsbedingungen zur Bauausführung die in einer Vielzahl von Punkten von den Regelungen der VOB/B abweichen und sich teilweise am Bauvertragsrecht des BGB (§ 650a ff. BGB) orientieren.
2
Bei Widersprüchen im Vertrag sollten abweichend von § 1 Abs. 2 VOB/B nacheinander folgende Vertragsbestandteile gelten:
- die Leistungsbeschreibung (LV-Vorbemerkungen, Positionstexte, Pläne, Zeichnungen, Berechnungen, Gutachten)
- die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB), siehe unten 2.1,
3.
die Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen (ZTV), siehe unten 3
4.
die VOB/B 2016 und die VOB/C 2019, jedoch mit folgenden Abweichungen und Ergänzungen.
3
Seite 4 bis 14 der Leistungsbeschreibung weisen Änderungen bzw. Modifikationen und Konkretisierungen zu zahlreichen Vorschriften der VOB/B auf.
4
Die Abweichungen umfassen beispielsweise den Ausschluss der Null-Abschnitte und der Abrechnungsbestimmungen der VOB/C, das Recht der Antragsgegnerin zur Ersatzvornahme ohne vorherige Auftragsentziehung abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B, die Berechtigung der Antragsgegnerin, neue Vertragsfristen nach billigem Ermessen festzulegen, die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Behinderungsanzeige selbst bei Offenkundigkeit, die Verlängerung der Frist des § 6 Abs. 7 VOB/B auf 6 Monate, den Ausschluss von § 7 und 12 Abs. 6 VOB/B und den Ausschluss von Teilabnahme und fiktiver Abnahme.
5
Die Antragstellerin rügte mit Schreiben vom 21.06.2021, dass die Ausschreibungsunterlagen gegen § 8a VOB/A verstoßen würden, da sie gravierende Abweichungen und Ergänzungen zu den Regeln der VOB/B aufweisen würden. Es sei der Antragstellerin deshalb unmöglich ein Angebot abzugeben. Außerdem rügte sie, dass die Frist zur Angebotsabgabe widersprüchlich sei, einmal sei diese auf den 12. und einmal auf den 15.07.2021 festgelegt worden.
6
Mit Änderungsbekanntmachung vom 29.06.2021 legte die Antragsgegnerin die Angebotsfrist auf den 15.07.2021 fest und teilte der Antragstellerin mit Schreiben vom 29.06.2021 mit, dass sie ihrer Rüge nicht abhelfen werde. Die Antragsgegnerin sei bewusst von den Regelungen der VOB/B abgewichen und habe die Ausschreibung explizit auf das Bauvorhaben zugeschnitten, da eine unveränderte Anwendung der VOB/B in der Realität nicht möglich sei. Außerdem habe die Antragsgegnerin bestimmte Regelungen, insbesondere für die Abtretung/Aufrechnung/Zurückbehaltung und den gesetzlichen Mindestlohn/keine Schwarzarbeit treffen müssen, da diese in der VOB/B nicht geregelt seien.
7
Die Antragstellerin stellte daraufhin mit Schreiben vom 07.07.2021 31 Bieterfragen zu den Ausschreibungsunterlagen. Diese wurden von der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 09.07.2021 beantwortet.
8
Bieterfrage 27 zu Pos. 5.1.1.8 Perimeterdämmung lautet:
9
Gem. LV-Langtext ist einen Perimeterdämmung 1-lagig in Dämmstärke 180 mm, mit Zulässiger Druckspannung von 255 kN/m2 anzubieten. Produkte mit einer Dämmerstärke von 180 mm, haben aber gem. Zulassung eine geringere Druckspannung von 210 kN/m2. Was ist zu kalkulieren 1-lagig oder eine 2-lagige Verlegung um die Dämmstärke von 180 mm zu erreichen?
Die Antragsgegnerin antwortete auf die Frage:
10
Die Verlegung ist 1-lagig zu kalkulieren.
11
Bieterfrage 29 zu Pos. 5.1.1.2 bis 12 und 16 bis 21 lautet: 1) Bei den Perimeterdämmungen fehlt im Langtext eine Materialangabe, wie z.B auch bei Pos. 5.1.1.1. Soll hier auch XPS-Dämmung angeboten werden?
12
2) In den verschieden Langtexten zu den Positionen werden immer wieder nur WLG 035 (außer bei Pos. 5.1.1.20 – 21 WLG 040) angegeben. Die WLG 035 ist keine eindeutige Bezeichnung. Der Lambdawert ist abhängig von der Dämmstärke, so das zur Kalkulation die geforderten Lambdawerte nach DIN 13164 benötigt werden.
13
Die Antragsgegnerin antwortete auf die Frage:
14
Ja, XPS z. B. Styrodur 4000 CS, Austrotherm oder gleichwertig Lambdawerte nach DIN 13164 0,035 für Dämmstärken d=60, 80 100, 120, 140, 160, 200, 240 mm.
15
Bieterfrage 31 zu Pos. 5.1.38 – 42 lautet:
16
Abdichtung KMB: Leistungsbeschreibung ist nicht eindeutig. Es fehlen sämtlich kalkulationsrelevanten Angaben, wie zum Beispiel die Angabe der Wassereinwirkungsklasse, Schichtdicke etc. Wir bitten um Ergänzung dieser Angaben.
17
Die Antragsgegnerin antwortete auf die Frage:
18
Abdichtung von außen von erdberührten Bauteilen gegen Einwirkung von Bodenfeuchte und nichtdrückendem Wasser nach DIN 5533 Schichtdicke gesamt: mind. 4 mm Verbrauch je nach Fabrikat: ca. 1,4 kg/m2/mm Trockenzeit 48h bei 20°C/70% Luftfeuchtigkeit Temperatur: 5° bis 35°C Risseüberbrückend Lösungsmittelfrei Kunststoffmodifiziert Wassereinwirkungsklasse gemäß DIN 18533, W1.1- E/W1.2-ENV2.1-E/W3-E/VV4-E Da die Antragstellerin die Antworten der Antragsgegnerin jedoch nicht für geeignet hielt, den Sachverhalt endgültig aufzuklären, rügte sie weitere Vergaberechtsverstöße, insbesondere einen Verstoß gegen § 12a EU Abs. 3 Nr. 3 VOB/A, widersprüchliche Antworten zur Perimeterdämmung und zur Wassereinwirkungsklasse, eine versteckte Produktvorgabe auf das Produkt Styrodur 4000 CS, die unzulässige Ausgestaltung der Winterbaumaßnahmen als Bedarfsposition und erneut Abweichungen von der VOB/B.
19
Diese Verstöße rügte sie erneut mit anwaltlichem Schreiben vom 12.07.2021 und kündigte einen Nachprüfungsantrag an. Mit Schreiben vom 14.07.2021 teilte die Antragsgegnerin mit, dass sie der Rüge nicht abhelfen werde.
20
Nachdem den Rügen der Antragstellerin nicht abgeholfen wurde, stellte die Antragstellerin mit Schreiben vom 12.07.2021 einen Nachprüfungsantrag gem. § 160 Abs. 1 GWB.
21
Der Nachprüfungsantrag sei zulässig und begründet. Die Antragstellerin habe ihr Interesse am Auftrag durch die Rügen und die Stellung eines Nachprüfungsantrags hinreichend dargelegt und sei damit unstrittig antragsbefugt. Auf Grund der vergaberechtswidrigen Verdingungsunterlagen sei es ihr nicht möglich und zumutbar gewesen ein Angebot abzugeben.
22
Die Verdingungsunterlagen, insbesondere der Abschnitt „B-Bauvertrag“ seien vergaberechtswidrig, da sie weitestgehend von der VOB/B zu Lasten des Auftragnehmers abweichen würden. Teilweise seien die Vertragsbedingungen unangemessen für den Auftraggeber und würden einer Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB nicht standhalten. Auch die Bezeichnung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen als „Besondere Vertragsbedingungen“ und nicht als Zusätzliche Vertragsbedingungen sei falsch, man könne die Bestimmungen die für Zusätzliche Vertragsbedingungen gelten nicht einfach durch eine andere Bezeichnung umgehen, wenn es sich unzweifelhaft um solche handle. Insgesamt würden die Verdingungsunterlagen gegen § 8a EU VOB/A und die Verpflichtung eines öffentlichen Auftraggebers ausgewogene Vertragsbedingungen auszuschreiben verstoßen und seien damit vergaberechtswidrig. § 8a EU VOB/A entfalte dabei auch bieterschützende Wirkung. Weiter seien auch insbesondere die Regelungen zur Bauzeit widersprüchlich, unangemessen und vergaberechtswidrig. Insbesondere die fehlenden Regelungen im Zusammenhang mit den Perimeterdämmungen würden der volatilen Marktsituation keine Rechnung tragen, diese „besonderen Schwierigkeiten“ hätte die Antragsgegnerin jedoch gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 VOB/B berücksichtigen müssen.
23
Auch enthalte die Ausschreibung unerfüllbare Bedingungen und die Leistungsbeschreibung sei weder eindeutig noch vollständig. Ferner sei eine ordnungsgemäße Kalkulation unmöglich, da Angaben, die für die Preisermittlung relevant seien, fehlen würden.
24
Die Antragstellerinbeantragt
25
- Der Antragsgegnerin wird es untersagt, auf der Grundlage der in ihrer Ausschreibung „Neubau Feuerwehrgerätehaus mit Wohnnutzung in U…, VE 103 Baumeisterarbeiten“ … festgelegten Bedingungen den Zuschlag zu erteilen.
26
- Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, wegen der Bauleistungen, die Gegenstand der vorbezeichneten Ausschreibung sind, ein ordnungsgemäßes Vergabeverfahren nach Maßgabe der VOB/A-EU unter Beachtung der Rechtsauffassung der Vergabekammer durchzuführen. Hierbei sind die im Nachprüfungsantrag von der Antragstellerin geltend gemachten Rechtsverletzungen zu vermeiden und abzustellen. Insbesondere werden der Antragsgegnerin folgende Vorgaben auferlegt:
27
- Es ist in den Verdingungsunterlagen vorzusehen, dass in dem Bauvertrag die Regelungen der VOB/B insgesamt ohne Abweichung vereinbart werden.
28
- Die Ausschreibung darf keine Vorgabe von Vertragsbestimmungen enthalten, welche den Bieter und späteren Auftragnehmer unangemessen benachteiligen.
29
- Die Ausschreibung hat ein Termingerüst, sowohl hinsichtlich der Planlieferung als auch hinsichtlich der Bauleistungen selbst, zu enthalten,
– in dem die Ausführungsfristen ausreichend bemessen sind,
– in dem besondere Schwierigkeiten, insbesondere in Form der derzeitigen fehlenden Prognostizierbarkeit, welche Lieferzeiten bestimmte Baumaterialien, beispielsweise Perimeterdämmungen, haben, angemessen berücksichtigt werden,
– welches eine angemessene Vorlaufzeit nach Zuschlagserteilung von mindestens 10 Wochen beinhaltet,
– das in sich widerspruchsfrei ist, insbesondere nicht einerseits einen festen Beginntermin und andererseits die Befugnis des Auftraggebers, den Baubeginn mit einem Vorlauf von 12 Werktagen zu fordern, beinhaltet.
30
- In den Positionen 5.1.1.2 bis 12 und 16 bis 21 des Leistungsverzeichnisses sind die Produkte so auszuschreiben, dass sie zu marktüblichen Konditionen bezogen werden können. Insbesondere ist der Lambdawert so zu bemessen, dass auf dem Markt erhältliche Produkte diesen aufweisen.
31
- In Position 5.1.1.8 sind Produkte auszuschreiben und zu definieren, die auf dem Markt zu üblichen Konditionen angeboten werden. Es ist zu vermeiden, dass eine Druckspannung vorgegeben wird, welche keines der marktüblichen Produkte für die betreffende Dämmstärke vorweist.
32
- Hinsichtlich der Positionen 5.1.2.38 bis 42 ist eindeutig festzulegen, welche Einwirkungsklasse der Abdichtung nach DIN 18533 vorgeschrieben ist und ob zur Ausführung der Leistung eine Verstärkung notwendig wird.
33
- In Abschnitt 1.1.4 des Leistungsverzeichnisses ist auf Seite 51 folgende Formulierung ersatzlos zu streichen:
„Der Auftraggeber behält sich vor, einzelne Leistungsbereiche oder Positionen im Auftragsfall zu streichen, ohne dass sich hierdurch Änderungen der Einheitspreise ergeben.
Aus Änderungen können keine Ansprüche abgeleitet werden.
Gleiches gilt für Massenminderungen und -mehrungen.
Es besteht kein Anspruch des AN auf Ausführung und Abrechnung der nachfolgenden Positionen zum Winterbau.
Ausführung aller unter Titel 1.5 aufgeführten Positionen nur nach Anmeldung der Leistungen durch den AN an AG/Objektüberwachung, Abstimmung und auf gesonderte Anweisung durch die Objektüberwachung und Freigabe durch den Bauherrn.“
34
- Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung erforderlichen Aufwendungen der Antragstellerin.
35
- Die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin wird für notwendig erklärt.
36
- Der Antragstellerin wird Akteneinsicht gemäß § 165 abs. 1 GWB gewährt.
37
Die Antragsgegnerinbeantragt
38
- Den Nachprüfungsantrag als unzulässig zu verwerfen, hilfsweise als unbegründet zurückzuweisen,
2.
Der Antragstellerin die Kosten des Nachprüfungsverfahrens einschließlich der zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Auslagen der Antragsgegnerin aufzuerlegen,
3.
Die Hinzuziehung der Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin für notwendig zu erklären.
39
Zur Begründung trägt die Antragsgegnerin vor, dass der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin schon nicht zulässig gewesen sei, da sie ihr Interesse an dem Auftrag nicht schlüssig und substantiiert dargelegt habe. Eine Angebotsabgabe sei ihr zumutbar gewesen.
40
Weiter trägt die Antragsgegnerin vor, dass es unmöglich sei die VOB/B als Ganzes zu vereinbaren, da schon die kleinste Änderung zum Verlust der Privilegierung führe und Änderungen in der Praxis regelmäßig wegen der Besonderheiten des Vorhabens vorgenommen werden müssten. Auch sei § 8a EU VOB/A nicht bieterschützend, die Antragstellerin könne ihren Nachprüfungsantrag nicht darauf stützen. Wäre § 8a EU VOB/A bieterschützend hätte dies zur Folge, dass zivilrechtliche Auseinandersetzungen in das Vergabenachprüfungsverfahren verlagert werden. Ferner begünstigt der Entfall der Privilegierung der VOB/B auch den Bieter und ist somit kein Nachteil für diesen. Die Antragsgegnerin habe die Besonderen Vertragsbedingungen richtigerweise als solche benannt. Insgesamt enthielten die Verdingungsunterlagen Klarstellungen der Gesetzeslage auf Basis der Rechtsprechung, außerdem lägen sie im Interesse beider Parteien und würden gerade nicht die Bieter benachteiligen. Durch die Vertragsbedingungen würde den Bietern auch kein Schaden entstehen. Ferner trägt die Antragsgegnerin vor, dass im Vergabenachprüfungsverfahren keine zivilrechtliche Wirksamkeitskontrolle durchgeführt werde, insbesondere eine AGB-Kontrolle könnte hier nicht stattfinden. Die Vertragsbedingungen würden jedoch entgegen der Behauptungen der Antragstellerin selbstverständlich einer solchen Überprüfung standhalten und seien rechtmäßig. Die Leistungsbeschreibung sei eindeutig und vollständig und enthalte hinreichende Angaben und erfüllbare Bedingungen.
41
Ferner seien auch die Fristen eindeutig und angemessen, die Antragsgegnerin habe insbesondere die Beschaffung der Perimeterdämmung bei der Fristfestlegung nicht berücksichtigen müssen, dies sei Beschaffungsrisiko des Bieters.
42
Da die Verdingungsunterlagen rechtmäßig seien, sei keine Rechtsverletzung der Antragstellerin ersichtlich, selbst bei einem unterstellten Vergaberechtsverstoß drohe der Antragstellerin kein Schaden durch Beeinträchtigung ihrer Aussichten auf den Erhalt des Zuschlags. Der Nachprüfungsantrag sei damit zumindest auch nicht begründet.
43
Mit Schreiben vom 09.12.2021 hat die Vergabekammer Südbayern einen rechtlichen Hinweis an die Antragsgegnerin erteilt und mitgeteilt, dass der Nachprüfungsantrag der Antragstellerin nach derzeitiger Rechtsauffassung der Vergabekammer zulässig und begründet sei. Die Antragstellerin habe ihr Interesse am Auftrag durch die Rügen und die Stellung des Nachprüfungsantrags hinreichend dargelegt. Ferner sei insbesondere auch § 8a EU VOB/A nach derzeitiger Rechtsauffassung der Vergabekammer bieterschützend.
44
Die Vergabekammer kam weiter zu der vorläufigen Einschätzung, dass die Ausschreibung und insbesondere die Vertragsbedingungen Vergaberechtsverstöße enthalten würden, da sie ein tiefgreifend geändertes Regelwerk enthielten, welches nicht nur punktuell von der VOB/B abweiche. Weiter führt die Vergabekammer aus, dass eine AGB-Kontrolle nicht von der Vergabekammer ausgeführt werde, auf die zivilrechtliche Beurteilung komme es hier nach derzeitiger Auffassung der Vergabekammer jedoch nicht an.
45
Die Vergabekammer hat mit deren Zustimmung und nach Verzicht auf eine mündliche Verhandlung am 08.02.2022 die Sach- und Rechtslage per Videokonferenz mit den Beteiligten erörtert. Die Verfahrensbeteiligten hatten Gelegenheit zum Vortrag und zur Stellungnahme.
46
Der ehrenamtliche Beisitzerhat die Entscheidung über die Beiladung, den Umfang der Akteneinsicht sowie im Falle einer Verfahrenseinstellung auf den Vorsitzenden und die hauptamtliche Beisitzerin übertragen.
47
Die Beteiligten wurden durch den Austausch der jeweiligen Schriftsätze informiert. Auf die ausgetauschten Schriftsätze, das Protokoll der Erörterung, die Verfahrensakte der Vergabekammer sowie auf die Vergabeakten, soweit sie der Vergabekammer vorgelegt wurden, wird ergänzend Bezug genommen.
II.
48
Die Vergabekammer Südbayern ist für die Überprüfung des streitgegenständlichen Vergabeverfahrens zuständig.
49
Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Vergabekammer Südbayern ergibt sich aus §§ 155, 156 Abs. 1, 158 Abs. 2 GWB i. V. m. §§ 1 und 2 BayNpV.
50
Gegenstand der Vergabe ist ein Bauauftrag i. S. d. § 103 Abs. 3GWB. Die Antragsgegnerinist Auftraggeber gemäß §§ 98, 99 Nr. 1 GWB. Der geschätzte Gesamtauftragswert überschreitet den gemäß § 106 GWB maßgeblichen Schwellenwert in Höhe von 5.350.000 Euro.
51
Eine Ausnahmebestimmung der §§ 107 – 109 GWB liegt nicht vor.
52
- Der Nachprüfungsantrag ist zulässig.
53
1.1. Gemäß § 160 Abs. 2 GWB ist ein Unternehmen antragsbefugt, wenn es sein Interesse am Auftrag, eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB und zumindest einen drohenden Schaden darlegt.
54
Die Antragstellerinhat ihr Interesse am Auftrag zwar nicht durch die Abgabe eines Angebots nachgewiesen. Sie hat aber rechtzeitig Rügen gegen die Gestaltung der Vergabeunterlagen, insbesondere der Vertragsbedingungen erhoben und die Unklarheit einzelner Positionen des LV bemängelt. Damit und mit der Stellung des streitgegenständlichen Nachprüfungsantrags hat sie ihr Interesse am Auftrag hinreichend nachgewiesen. Es ist nicht erkennbar, dass sie mit diesem Nachprüfungsantrag einen anderen Zweck verfolgt, als den, den strittigen Auftrag zu erhalten.
55
1.2. Der Zulässigkeit des Nachprüfungsantrags steht auch keine Rügepräklusion nach § 160 Abs. 3 S. 1 Nr. 1, 2 oder 3GWB entgegen. Die Antragstellerin hat mit ihren Rügen eines Verstoßes der Vertragsbedingungen in den Vergabeunterlagen gegen § 8aEU VOB/A und zur Widersprüchlichkeit der Fristen und Termine vom 21.06.2021 ihrer Rügeobligenheit sowohl nach § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 als auch Nr. 3 GWB genüge getan. Gleiches gilt auch für die weiteren Rügen vom 09.07.2021 bzgl. der Vorgaben des Leistungsverzeichnisses zur Perimeterdämmung sowie zur ausgeschriebenen Wassereinwirkungsklasse. Hier erfolgte die Rüge noch am selben Tag, an dem die Antragstellerin die – aus ihrer Sicht unzureichenden – Antworten auf ihre Bieterfragen vom 07.07.2021 erhalten hatte.
56
1.3. Es bestehen auch keine Bedenken gegen die Antragsbefugnis der Antragstellerin.
57
Die Antragstellerin hat rechtzeitig vor dem Termin zur Angebotsabgabe verschiedene von ihr angenommene Verstöße gegen vergaberechtliche Vorschriften gerügt. Sie hat ihr Interesse am Auftrag somit durch diese Rügen und die Stellung des streitgegenständlichen Nachprüfungsantrags in ausreichendem Maße dargelegt.
58
Ein Unternehmen, das rechtzeitig Vergabeverstöße gerügt hat, die im Falle ihres Vorliegens eine Korrektur der Vergabeunterlagen erfordern, muss zum Erhalt seiner Antragsbefugnis kein Angebot in dem seiner Ansicht nach fehlerhaften Vergabeverfahren abgeben. Die Antragstellerin hat in ausreichendem Maße vorgetragen, warum sie eine Angebotsabgabe für unzumutbar hielt. Einer weiteren Darlegung bedarf es nicht. Insbesondere muss ein Bieter in einer solchen Situation nicht darlegen, dass ihm eine Angebotsabgabe unmöglich wäre oder er an jeglicher zumutbaren Kalkulation gehindert wäre.
59
1.4. Die von der Antragstellerin gerügten Verstöße gegen vergaberechtliche Normen sind auch bieterschützend und können in einem vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden.
60
In Bezug auf die gerügten Verstöße gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung gem. § 121 GWB aufgrund der LV-Positionen und Antworten auf die Bieterfragen zur Perimeterdämmung und zur Wassereinwirkungsklasse bedarf dies keiner näheren Darlegung.
61
Nach Auffassung der Vergabekammer Südbayern gilt dies aber auch für Verstöße gegen § 8aEU VOB/A. Diese Vorschrift schreibt vor, dass bei Aufträgen, die im Rahmen von Vergabeverfahren VOB/A vergeben werden, die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden müssen. Sie trifft damit primär Regelungen für die spätere Phase der Auftragsdurchführung, allerdings mit Relevanz für die Kalkulation der Bieter im Vergabeverfahren.
62
Vergaberechtliche Intention der Vorschrift ist es, dafür zu sorgen, dass die VOB/B als Ganzes Anwendung findet und damit nach der Rechtsprechung des BGH (BGH Urteil vom 10.5.2007 – VII ZR 226/05, Urteil vom 22.1.2004 – VII ZR 419/02) eine gesonderte Inhaltskontrolle der einzelnen Regelungen der VOB/B nach §§ 307 ff. BGB nicht stattfindet. Im Vergabeverfahren wird durch diese Regelung dem Interesse des Bieters Rechnung getragen, unabhängig von Unsicherheiten über die Geltung der Regelungen der VOB/B und der Frage der Inhaltskontrolle von AGBs sein Angebot kalkulieren zu können. Hinzu kommt noch, dass alle Beteiligten am Bau aufgrund langjähriger Übung auch ohne juristische Beratung die Regelungen der VOB/B in den Grundzügen kennen und ihr Handeln daran ausrichten. Von jedem Auftraggeber selbst zusammengestellte Bauverträge müssten – auch wenn sie sich am Leitbild des Bauvertragsrechts des BGB orientieren mögen und keine die Auftragnehmer unangemessen beeinträchtigenden Regelungen enthalten – immer von den Bietern im Einzelfall aufwändig kalkulatorisch bewertet werden. Auch dies soll § 8aEU VOB/A vermeiden Die Norm könnte insoweit auch als gesondert normierte Ausprägung des anerkannt bieterschützenden Verbots in § 7EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A, dem Bieter ungewöhnliche Wagnisse aufzuerlegen, anzusehen sein.
63
Vor dem Hintergrund der Kalkulationsrelevanz können Verstöße eines Auftraggebers gegen § 8aEU VOB/A nach Auffassung der Vergabekammer Südbayern ohne Weiteres im Vergabenachprüfungsverfahren geltend gemacht werden, da es sich (auch) um vergaberechtliche Normen handelt. Jedenfalls wenn die Abweichungen von der VOB/B zu einer Verschärfung der Regelungen zu Lasten des Bieters führen oder führen können, ist die Norm bieterschützend (VK Sachsen, Beschluss vom 13.12.2013 – 1/SVK/038-13).
64
Im vorliegenden Fall hat die Antragsgegnerin in ihren sog. Besonderen Vertragsbedingungen ein in weiten Bereichen von der VOB/B abweichendes Regelwerk aufgestellt, das sich teilweise am Bauvertragsrecht des BGB orientiert. Die VOB/B gilt demgegenüber nur nachrangig und mit den zahlreichen Ergänzungen durch die sog. Besonderen Vertragsbedingungen.
65
Da aufgrund der Vielzahl der Abweichungen nicht mehr davon auszugehen ist, dass die VOB/B als Ganzes vereinbart ist und eine AGBrechtliche Privilegierung der Regelungen vorliegt, unterliegt die Antragstellerin hier genau den Kalkulationsrisiken, vor denen § 8aEU VOB/A die Bieter schützen soll.
66
Zudem benachteiligen nach dem Vortrag der Antragstellerin zahlreiche der Änderungen den künftigen Auftragnehmer im Vergleich zu den Regelungen der VOB/B, was zu weiteren Kalkulationsrisiken führt. Dies führt zu einer potentiellen Verschlechterung der Zuschlagschancen der Antragstellerin und kann von ihr im vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahren geltend gemacht werden.
67
Die Vergabekammer teilt insbesondere nicht die Auffassung der Antragsgegnerin, dass § 8aEU VOB/A schon deshalb nicht als bieterschützend angesehen werden kann, weil keine entsprechende Regelung in der RL 2014/24/EU besteht. Den Mitgliedsstaaten ist es unbenommen über die Regelungen der Richtlinie hinausgehende bieterschützende Normen zu schaffen, wie z.B. die deutschen Regelungen zur Losvergabe in § 97 Abs. 4 GWB zeigen.
68
Auch die von der Antragsgegnerin geäußerten Zweifel, ob § 8aEU VOB/A über die Verweisung des § 2 VgV von der Verordnungsermächtigung des § 113 GWB gedeckt ist, führen nicht dazu, die Norm als nicht bieterschützend anzusehen. Zu einen ist keineswegs eindeutig, dass § 8aEU VOB/A nicht von der Verordnungsermächtigung des § 113 GWB gedeckt ist, da diese auch die Befugnis zur Regelung von Anforderungen an den Auftragsgegenstand, wozu auch vertragliche Regelungen gehören können, und zum Abschluss des Vertrags umfasst. Andererseits hält sich die Vergabekammer in Fällen in denen es nicht um den Anwendungsvorrang des Europarechts geht, nicht zu einer Inzidentverwerfung einer untergesetzlichen Rechtsnorm befugt.
69
- Der zulässige Nachprüfungsantrag ist auch begründet. Die streitgegenständlichen Vergabeunterlagen verstoßen eklatant gegen § 8aEU VOB/A, zudem liegt zumindest bei der Pos. 5.1.1.8 auch ein Verstoß gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung gem. § 121 GWB vor.
70
2.1. Gem. § 8aEU Abs. 1 VOB/A ist in den Vergabeunterlagen vorzuschreiben, dass die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B) und die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB/C) Bestandteile des Vertrags werden. Nach § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 1 VOB/A müssen die Regelungen der VOB/B grundsätzlich unverändert bleiben. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass durch die abweichenden Vereinbarungen der Parteien ein Eingriff in die Regelungen der VOB/B vorgenommen wird und auf diese Weise die VOB/B ihre Privilegierung als Allgemeine Geschäftsbedingung verliert.
71
Von diesem Grundsatz sind folgende Ausnahmen möglich: Gem. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 2 VOB/A können Auftraggeber, die ständig Bauleistungen vergeben, die Regelungen der VOB/B für die bei ihnen allgemein gegebenen Verhältnisse durch Zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen. Diese Zusätzlichen Vertragsbedingungen dürfen den Regelungen der VOB/B gem. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A allerdings nicht widersprechen. Ferner können nach § 8aEU Abs. 2 Nr. 2 VOB/A die Regelungen der VOB/B durch Besondere Vertragsbedingungen ergänzt werden, wobei sich Abweichungen auf die Fälle beschränken sollen, in denen in der VOB/B eine besondere Vereinbarung ausdrücklich vorgesehen ist und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 13).
72
Es spricht im vorliegenden Fall viel dafür, dass die vertraglichen Regelungen unter B -Bauvertrag Ziffer 2.1 der Vergabeunterlagen als Zusätzliche Vertragsbedingungen i.S.d. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 2 VOB/A anzusehen sind, da sie ersichtlich für eine Vielzahl von Bauvergaben der Antragsgegnerin konzipiert wurden. Derartige Zusätzliche Vertragsbedingungen werden regelmäßig als Allgemeine Geschäftsbedingungen gem. § 305 Abs. 1 BGB einzustufen sein, mit der Konsequenz, dass die einzelnen Regelungen der Zusätzlichen Vertragsbedingungen der Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB unterfallen, falls keine Privilegierung durch die Vereinbarung der VOB/B als Ganzes eingreift (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 16).
73
Zusätzliche Vertragsbedingungen dürfen den Allgemeinen Vertragsbedingungen der VOB/B gem. § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A jedoch nicht widersprechen, sondern die Regelungen der VOB/B allenfalls konkretisieren oder näher ausgestalten. Eine Konkretisierung der Regelungen der VOB/B kommt beispielsweise dort in Betracht, wo die VOB/B unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet. Für nähere Ausgestaltungen ist insbesondere dort Raum, wo die Regelungen der VOB/B eine gesonderte Abrede zwischen den Parteien voraussetzen. Dies ist z.B. der Fall bei Regelungen zu Ausführungsfristen, die nach § 5 Abs. 1 VOB/B einer Vereinbarung zwischen den Parteien bedürfen oder bei einer Vertragsstrafe gem. § 11 VOB/B.
74
Eine Konkretisierung bzw. Ausgestaltung der VOB/B kommt auch dort in Betracht, wo die Regelungen der VOB/B sogenannte Öffnungsklauseln („wenn nichts anderes vereinbart ist“) enthalten (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 17-20).
75
Die von der Antragsgegnerin getroffenen Regelungen gehen weit über diese zulässigen Konkretisierungen oder in der VOB/B vorgesehenen Ausgestaltungen hinaus.
76
Dies beginnt schon damit, dass nach den Regelungen in den Vergabeunterlagen die VOB/B gerade nicht als Allgemeine Vertragsbedingungen vereinbart sein soll. An ihre Stelle treten die sog. „Besonderen Vertragsbedingungen“ unter Ziffer 2.1, die VOB/B soll nur subsidiär und im Rahmen der zahlreichen Modifikationen gelten.
77
Keine zulässige Konkretisierung oder in der VOB/B vorgesehenen Ausgestaltung stellen beispielsweise folgende Punkte dar:
– der Ausschluss der Null-Abschnitte und der Abrechnungsbestimmungen der VOB/C
– das Recht zur Ersatzvornahme ohne vorherige Auftragsentziehung abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B
– die in der VOB/B nicht vorgesehene Berechtigung der Antragsgegnerin, neue Vertragsfristen nach billigem Ermessen festzulegen
– die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Behinderungsanzeige selbst bei Offenkundigkeit entgegen § 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B
– die Verlängerung der Frist des § 6 Abs. 7 VOB/B auf 6 Monate
– der Ausschluss von § 7 und 12 Abs. 6 VOB/B
– der Ausschluss von Ausschluss von Teilabnahme und fiktiver Abnahme in Abweichung von § 12 Abs. 2 und Abs. 5 VOB/B Auf Vertragsklauseln der Antragsgegnerin, bei denen die Frage einer zulässigen Abweichung von der VOB/B von der Auslegung zivilrechtlicher Rechtsprechung abhängt wie bei den Abänderungen der Regelungen des § 1 Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B bei Änderungen des Bauentwurfs bzw. Werkerfolgs oder des § 2 Abs. 5 ff VOB/B bei zusätzlichen Vergütungsansprüchen im Falle von Änderungsanordnungen, kommt es damit für die Annahme eines Verstoßes gegen § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A überhaupt nicht an.
78
Von der Antragsgegnerin gewollt sind hier keine punktuellen Abweichungen von den Regelungen der VOB/B oder dort vorgesehene Ausgestaltungen oder Konkretisierungen, sondern ein tiefgreifend geändertes Regelwerk, das sich teilweise maßgeblich am Bauvertragsrecht des BGB orientiert. Ein solches gegenüber der VOB/B tiefgreifend geändertes Regelwerk lässt § 8aEU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A bei öffentlichen Bauausschreibungen aber gerade nicht zu.
79
Für die vergaberechtliche Beurteilung ist es ohne jeden Belang, ob die etwaigen Regelungen etwa dem gesetzlichen Leitbild des BGB-Bauvertragsrechts entsprechen oder einer AGB-Inhaltskontrolle nach §§ 307 ff. BGB standhalten würden. Dies ist von der Vergabekammer nicht zu entscheiden, sondern Sache der ordentlichen Gerichte. Intention des § 8aEU VOB/A ist, dass sich derartige Fragen in einem Vergabeverfahren überhaupt nicht stellen.
80
An diesem Ergebnis würde sich auch nichts ändern, wenn man die Regelungen als Besonderen Vertragsbedingungen i.S.d. § 8 EU Abs. 2 Nr. 2 S. 2 VOB/A ansehen würde, auch wenn dafür nach Auffassung der Vergabekammer keine Anhaltspunkte ersichtlich sind. Denn auch die Besonderen Vertragsbedingungen sollen sich auf Fälle beschränken, in denen nach der VOB/B besondere Vereinbarungen ausdrücklich vorgesehen sind und auch nur soweit es die Eigenart der Leistung und ihre Ausführung erfordern. Besondere Vereinbarungen sind in der VOB/B ausdrücklich dann vorgesehen, wenn die Regelungen der VOB/B eine gesonderte Abrede zwischen den Parteien voraussetzen (z.B. bei § 5 VOB/B, § 11 VOB/B, § 17 VOB/B) oder aber eine entsprechende Öffnungsklausel beinhalten (z.B. § 2 Abs. 4 VOB/B, § 2 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B, § 4 Abs. 4 VOB/B). Darüber hinaus müssen die Eigenart der Bauleistung und ihrer Ausführung die Aufnahme von Besonderen Vertragsbedingungen erfordern. Diese Voraussetzung wird regelmäßig bei komplexen Bauvorhaben mit hohen bautechnischen, baubetrieblichen und/oder terminlichen Anforderungen erfüllt sein (BeckOK VergabeR/Heinrich VOB/A § 8aEU Rn. 24, 25).
81
Auch Besondere Vertragsbedingungen i.S.d. § 8a EU Abs. 2 Nr. 2 S. 2 VOB/A erlauben jedoch kein so grundlegend von der VOB/B abweichendes Regelwerk wie das der Antragsgegnerin. Zudem fehlt jede dokumentierte Begründung, dass die Eigenart der Bauleistung und ihre Ausführung die Aufnahme einer Besonderen Vertragsbedingung erfordern würde.
82
Da zumindest einige der Abweichungen von der VOB/B – wie der Ausschluss der Null-Abschnitte und der Abrechnungsbestimmungen der VOB/C, das Recht zur Ersatzvornahme ohne vorherige Auftragsentziehung abweichend von § 4 Abs. 7 VOB/B oder die Verlängerung der Frist des § 6 Abs. 7 VOB/B auf 6 Monate – auch geeignet sind, die Rechtsstellung des Auftragnehmers im Vertragsvollzug gegenüber einer unveränderten Vereinbarung der VOB/B zu verschlechtern, läge auch dann eine Rechtsverletzung der Antragstellerin vor, wenn man dies zur Voraussetzung für den Bieterschutz der Regelung machen würde (vgl. VK Sachsen, Beschluss vom 13.12.2013 – 1/SVK/038-13). Die Vergabekammer Südbayern tendiert allerdings dazu, dass zumindest bei einem derart eindeutigen Verstoß gegen § 8aEU eine Verschlechterung der Rechtsstellung des künftigen Auftragnehmers im Vertragsvollzug gegenüber einer unveränderten Vereinbarung der VOB/B keine zwingende Voraussetzung für die Annahme von Bieterschutz nach § 97 Abs. 6 GWB ist.
83
2.2. Zumindest bei der Pos. 5.1.1.8 liegt gerade auch unter Berücksichtigung der Beantwortung der Bieterfragen der Antragstellerin ein Verstoß gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung gem. § 121 GWB vor.
84
Ungeachtet der zahlreichen weiteren Streitfragen zu dieser Position stellt jedenfalls die Forderung einer zulässigen Druckspannung von 255 kN/m2 für Produkte mit der Dämmstärke 180mm einen Verstoß gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung gem. § 121 GWB dar.
85
Die Antragsgegnerin ist inhaltlich der Rüge der Antragstellerin, dass sämtliche am Markt erhältlichen, ansonsten LVkonformen Produkte mit der Dämmstärke 180mm nur eine zulässige Druckspannung von 210 kN/m2 haben, nicht entgegengetreten, so dass die Vergabekammer davon ausgehen muss, dass die Rüge inhaltlich zutreffend ist.
86
Soweit die Antragsgegnerin vorträgt, dass ihre Antwort auf die diesbezügliche Bieterfrage der Antragstellerin mit dem Satz „Die Verlegung ist einlagig zu kalkulieren.“ nach dem objektiven Empfängerhorizont als Zustimmung zur Verwendung von Produkten mit einer geringeren Druckspannung von 210 kN/m2 verstanden werden müsste, kann ihr keinesfalls gefolgt werden. Nimmt der öffentliche Auftraggeber von einer ausdrücklichen, aber mit den am Markt erhältlichen Produkten unerfüllbaren Vorgabe der Leistungsbeschreibung im Rahmen einer Bieterfrage Abstand, muss er dies konkret und unmissverständlich tun. Die Antwort, dass die Verlegung einlagig zu kalkulieren sei, ist auch für einen fachkundigen Bieter vielmehr so zu verstehen, dass der Auftraggeber bei seiner unerfüllbaren Vorgabe bleibt, als dass er seine Zustimmung zu einer Verwendung von Dämmprodukten gibt, die lediglich eine zulässige Druckspannung von 210 kN/m2 haben. Die erforderliche Eindeutigkeit ist damit keinesfalls gegeben.
87
2.3. Vor dem Hintergrund des Verstoßes gegen § 8aEU VOB/A und dem Verstoß gegen das Gebot der eindeutigen und erschöpfenden Leistungsbeschreibung gem. § 121 GWB bedürfen die zahlreichen weiteren aufgeworfenen Fragen keiner abschließenden Entscheidung.
88
Das Vergabeverfahren muss ohnehin mindestens in den Stand vor Veröffentlichung der Vergabeunterlagen zurückversetzt und die Vergabeunterlagen korrigiert werden.
89
Die Vergabekammer Südbayern weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass hinsichtlich der Positionen Pos. 5.1.1.2 bis 12 und 16 bis 21 eine Klarstellung geboten ist, ob es auf den Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (λB) oder auf den Nennwert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN 13164 (λD) ankommt.
90
Die Streitfrage, ob im Verfahren die Übergabe der Planunterlagen am 17.08.2021 und der Beginn der Hauptleistungen der Baumeisterarbeiten am 13.09.2021 maßgeblich waren und die Regelung, dass mit der Ausführung der Leistung 12 Werktage nach Abruf des AG in Textform zu beginnen war, hierzu im Widerspruch stand, hat sich durch Zeitablauf aufgrund der Nachprüfungsverfahrens erledigt. Der Auftraggeber wird im Falle fortstehender Beschaffungsabsicht entweder neue Fristen festsetzen oder klarstellen müssen, dass nunmehr die Abruffrist von 12 Werktagen maßgeblich ist.
91
Die Vergabekammer Südbayern weist weiterhin darauf, dass die Unwägbarkeiten in welchem Umfang Winterbaumaßnahmen anfallen, möglicherweise ein sachlicher Grund für die Ausschreibung als Bedarfsposition sein könnten. Die Anforderungen hierfür sind nach § 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 VOB/A allerdings hoch. Nur solche Positionen, bei denen trotz Ausschöpfung aller örtlichen und technischen Erkenntnismöglichkeiten zum Zeitpunkt der Ausschreibung objektiv nicht feststellbar ist, ob und in welchem Umfang Leistungen zur Ausführung gelangen werden, dürfen als Bedarfs- bzw. Eventualposition ausgeschrieben werden (OLG Düsseldorf Beschluss vom 10.2.2010 – Verg 36/09). Allerdings kann die Regelung auf S. 51 des LV von einem verständigen Bieter durchaus so gelesen werden, dass die Auftraggeberin nicht verpflichtet ist, notwendige Winterbaumaßnahmen freizugeben und zu vergüten, obwohl ein Auftragnehmer Winterbaubedingungen leisten müsste. Da dies – nach Angaben der Antragsgegnerin – nicht ihrer Intention entspricht und sie lediglich eine Abstimmung des ausführenden Bauunternehmens mit der Bauleitung vor Ausführung der Winterbaumaßnahmen für erforderlich hält, wäre eine Klarstellung sachdienlich, wenn sich die Streitfrage nicht bereits durch Zeitablauf erledigt hat.