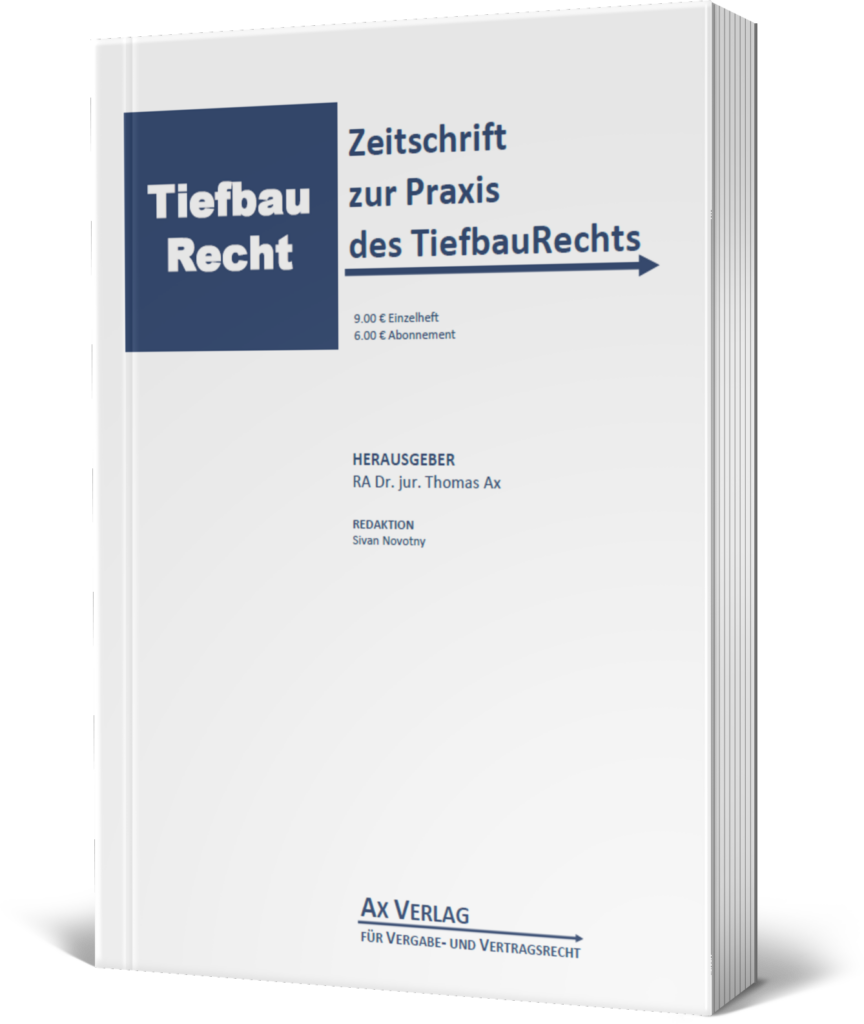vorgestellt von Thomas Ax
Zum Nachweis einer Verzögerungsentschädigung gemäß § 642 BGB iVm § 6 Abs. 6 S. 2 VOB/B genügt es nicht, die Verzögerung und die Stillstandszeit für Mannschaft und Gerät und die Vorhaltekosten darzustellen. Vielmehr muss konkret vorgetragen werden, welche Differenz sich bei einem Vergleich zwischen einem ungestörten und dem verzögerten Bauablauf ergibt. Macht ein Auftragnehmer einen Anspruch auf Entschädigung wegen Bauzeitverzögerung geltend, so kann für die Darlegung des nachweislich entstandenen Schadens bzw. der angemessenen Entschädigung eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung erforderlich sein. Dafür muss der Anspruchsteller zunächst den bauvertraglich vereinbarten Bauablauf, dann die genaue Behinderung und schließlich deren konkrete Auswirkungen auf seine Leistungen darlegen.
OLG Brandenburg, Urteil vom 20.07.2023 – 10 U 14/23
Gründe
I.
Die Parteien streiten über die Vergütung von Baumfällarbeiten.
Die Beklagte beauftragte die Klägerin nach einer Ausschreibung mit Zuschlagsschreiben vom 9. Februar 2017 (K 1, Bl. 290 d.A., K 2, Bl. 298 d.A.) mit der Durchführung von Fällarbeiten zur Baufeldfreimachung im Rahmen des Ausbaus der B101 zwischen (“Ort 01”) und (“Ort 02”) zu einer Auftragssumme von 9.596,20 Euro. Das Angebot der Klägerin enthielt im Hinblick auf die vorgesehene Verwertung von gefällten Bäumen durch die Klägerin teilweise negative Preise, da die Klägerin aus der Verwertung weitere Einnahmen erzielen konnte. Vertragsbestandteil sind die Baubeschreibung, das Blankett-Leistungsverzeichnis, die Zusätzlichen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau, die ZVB/E-StB 2014 und die Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen. Wegen der Einzelheiten wird auf die Anlagen K2 (Angebot, Bl. 298 ff. d.A.), K3 (Baubeschreibung, Bl. 305 ff. d.A.), K4 (Leistungsverzeichnis, B.. 334 ff. d.A.), K5 (ZVB, Bl. 358 ff. d.A.), und K6 (Besondere Vertragsbedingungen, Bl. 369 ff. d.A.), Bezug genommen.
Ausweislich der Baubeschreibung war Auftragsgegenstand die Baufeldfreimachung der B 101 zwischen (“Ort 01”) und (“Ort 02”) mit folgenden Hauptleistungen (Bl. 309 d.A.):
“Ca. 1.300 m2 Waldfläche abholzen
Ca. 160 St Straßenbäume Fällen D = 10 bis 30 cm
Ca. 50 St Straßenbäume fällen D = 30 bis 50 cm
Ca. 5.000 St Waldbäume fällen D = 10 bis 30 cm
Ca. 650 St Waldbäume fällen D = 30 bis 50 cm”
Unter Gliederungspunkt 3.1.2. der Baubeschreibung heißt es:
“Für die Absicherung der Fällarbeiten ist bei Bedarf eine Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer nach RSA-Regelplan C I/5 vorgesehen. Eine transportable Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, Typ C mit einer Energieversorgung nach Wahl des AN ist erforderlich. Diese Anlage ist bei Bedarf kurzfristig auf “Rot-Rot-Betrieb” zu schalten, wenn Fällarbeiten in dem unmittelbar angrenzenden Straßenseitenraum vorgenommen werden.”
Das Langtext Leistungsverzeichnis weist die Positionen 05.00 “Straßenbäume fällen” und unter 05.01 “Waldflächen abholzen” aus (Bl. 309 ff. d.A.). Dabei ist in den Unterpositionen zu 05.00 “Straßenbäume fällen” teilweise vorgesehen, dass die Baumkrone und der Stamm stufenweise abzutragen sind. In den Unterpositionen zu 05.01 Waldflächen ist dagegen ein stufenweises Abtragen nicht vorgesehen, dort können die Bäume mit einem Schlag gefällt werden. Darüber hinaus ist bei den Waldbäumen, die also in einem Schnitt gefällt werden können, überwiegend vereinbart, dass das geschlagene Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuzuführen ist, – also von diesem auch weiterveräußert werden kann. In der Vorbemerkung zu Position 05.00 “Straßenbäume fällen” des Leistungsverzeichnisses, heißt es:
“Fällung Südseite im Bereich der Mulde für die spätere Anlage eines Amphibienschutzzaunes”
Das wird konkretisiert unter Ziffer 1.1.1.8 der Baubeschreibung (Bl. 311 d.A.):
“Dazu kommen Straßenbäume, die für die Anlage eines Amphibien- und Reptilienschutzzaunes gefällt werden müssen. Dies sind ca. 160 Bäume mit einem Durchmesser bis zu 30 cm und ca. 50 Bäume mit einem Durchmesser von 30 cm bis 50 cm. Die Details sind den entsprechenden Leistungspositionen zu entnehmen”.
Mit Schreiben vom 15. Februar 2017 zeigte die Klägerin Mehr- und Minderkosten an (Bl. 500 d.A., K 33). Zudem müssten im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Bäume mit einem Stammdurchmesser von 0,5 bis 0,75 m gefällt werden, von denen sie 28 Stück gefällt habe.
Im Lauf der gegenständlichen Arbeiten sind Aufmaße erstellt worden, die neben der Menge der gefällten Bäume jeweils die Ordnungsziffern zumindest einer Leistungsverzeichnis-Position und deren Kurzbezeichnung enthielten und wegen deren genauen Inhalts auf Anlage 2 K13-K17, Bl. 430 ff. d.A. Bezug genommen wird.
Die Klägerin unterbreitete der Beklagten zudem mehrfach 4 Nachtragsangebote (K 31 Bl. 497 d.A.; K 25 Bl. 484 d.A.).
Die Beklagte nahm die Leistungen der Klägerin am 19. April 2017 ab (K 7, Bl. 375 ff. d.A.). Mit Schreiben vom 29. Juni 2017 übersandte die Klägerin eine Schlussrechnung über einen Betrag von 915.099,49 Euro (K 8, Bl. 379 ff. d.A). Die Beklagte prüfte die Schlussrechnung und ermittelte eine Gesamtleistung von 171.304,50 Euro und einen offenen Schlussrechnungsbetrag von 16.710,91 Euro, welchen die Beklagte auch zahlte.
Die Klägerin forderte die Beklagte zur Zahlung restlicher 714.471,85 Euro auf, wobei die Berechtigung eines Großteils der Forderung von der Antwort auf die Frage abhing, ob die Klägerin Anspruch auf Ausgleich entgangener Verwertungserlöse hat und ob Gutschriften bei Mengenmehrungen weiter gewährt werden müssen. Nachdem der 11. Senat des Brandenburgischen Oberlandesgerichts diese Frage in einem Parallelrechtsstreit verneint hat (OLG Brandenburg, Urteil vom 22. Januar 2020 – 11 U 153/18 -; nachgehend BGH, 10. Juni 2021, VII ZR 71/20, Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen sowie OLG Brandenburg, Urteil vom 25. September 2020 – 11 U 35/18 -; BGH, Urteil vom 10. Juni 2021 – VII ZR 157/20 -), macht die Klägerin nunmehr noch 136.363,03 Euro geltend, die Vergütung für die Fällung bestimmter Bäume (89.824,84 Euro), den Gemeinkostenausgleich (Mehr- und Mindermengen 5.436,878 Euro), Ansprüche wegen einer Baubehinderung beim Grundstück ### (5.333,24 Euro), fehlende Baufreiheit beim Grundstück ### (6.369,54 Euro) und die Vergütung von gefällten Bäumen mit 0,5 bis 0,75 m Durchmesser (offener Rest: 7.626,64 Euro).
Die Klägerin hat die Auffassung vertreten, dass sie die vorstehend aufgeführten Positionen ersetzt verlangen könne. Sie trägt hierzu vor:
Die Klägerin habe bei den Positionen 5.00.0002-0006 Leistungsverzeichnis (Straßenbäume fällen) erheblich mehr Bäume gefällt, als beglichen worden seien und könne deshalb die Zahlung weiterer 89.824,84 Euro verlangen. Dabei verteilten sich die Mehrmengen wie in der folgenden Tabelle angeführt:
“Leistungsverzeichnis: Vordersatz LV / Tatsächliche Menge / Mehrmenge
05.00.0002: 4 / 33 / 29
05.00.0003: 75 / 262 / 187
05.00.0004: 81 / 459 / 378
05.00.0005: 33 / 155 / 122
05.00.0006: 12 / 43 / 31″
Die Erbringung dieser Leistungen ergebe sich aus den gegengezeichneten Aufmaßblättern. Da diese Aufmaßblätter nicht nur die Anzahl der gefällten Bäume, sondern auch die jeweilige Position des Leistungsverzeichnisses anführten (K 13 ff, Bl. 430 ff. d.A.), die nunmehr der Abrechnung zu Grunde gelegt würden, enthielten diese Aufmaßblätter auch eine bindende Vereinbarung zwischen den Parteien. Diese habe zum Inhalt, dass die gefällten Bäume jeweils unter den Positionen des Leistungsverzeichnisses abzurechnen seien, die auf den Aufmaßblättern genannt seien. Es handele sich bei den, den Leistungsverzeichnis-Positionen 05.00 “Straßenbäume fällen”, zugerechneten Bäumen auch tatsächlich um die dort vorgesehenen Straßenbäume. Es habe sich nämlich während der Arbeiten herausgestellt, dass eine Vielzahl weiterer Bäume als in den Ausschreibungsunterlagen angeführt als Straßenbäume abschnittsweise hätten abgetragen werden müssen, weil deren Fällung in einem Stück in Straßennähe nicht zulässig gewesen sei. Das belege etwa das von der Klägerin eingeholte Privatgutachten ### (K 35, Bl. 580 ff. d.A.). Danach sei auch im Bereich der “Waldbäume” ein abschnittsweises Abtragen erforderlich geworden, weil diese überwiegend den erforderlichen Abstand von 6 Metern zum Straßenrand nicht einhielten, so dass es sich tatsächlich um Straßenbäume im Sinne des Leistungsverzeichnisses gehandelt habe. Das habe die Klägerin in ihrem Schreiben vom 24. Februar 2017 (K 37, Bl. 599 d.A.) auch ausgeführt und die Beklagte ausdrücklich bestätigt. Soweit der Gutachter ### meine, dass alle Bäume südlich der Straße “Straßenbäume” seien und alle Bäume nördlich “Waldbäume”, füge sich das ebenfalls in die Abrechnung der Klägerin ein. Denn ausweislich der Aufmaßblätter seien die gegenständlichen Bäume allesamt auf der Südseite der Straße abschnittsweise gefällt worden.
Neben den vorstehenden Mehrmengen seien in anderen Leistungsverzeichnis-Positionen erhebliche Mindermengen – insbesondere eine deutlich verringerte Anzahl gefällter Waldbäume – zu verzeichnen gewesen – korrespondierend zu den Mehrmengen in den Positionen 05.00 -, die vorstehend dargestellt worden sind. Anhand der Vorkalkulation ergebe sich ein Betrag von 5.436,88 Euro, der nicht durch Mehrmengen ausgeglichen werde. Hinsichtlich der Berechnung wird auf Bl. 281 f. d.A. Bezug genommen.
Die Klägerin hat ferner die Auffassung vertreten, dass sie beim Grundstück ### einen Betrag von 5.333,24 Euro wegen Baubehinderung gemäß § 642 BGB verlangen könne. Die Klägerin habe der Beklagten am 22. Februar 20217 mitgeteilt, dass das zu beräumende Grundstück ### vom Eigentümer nicht freigegeben worden sei (K 23, Bl. 480 d.A.). Die Baustelle habe daher beräumt werden müssen, um den eingesetzten Harvester kostenschonend anderweitig einzusetzen. Der Höhe nach ergebe sich die Forderung aus der Vorkalkulation in Verbindung mit dem erforderlichen Ab- und Antransport in Höhe von insgesamt 5.333,24 Euro (Bl. 285 d.A.).
Eine weitere Baubehinderung hat die Klägerin am Grundstück ### geltend gemacht. Dort habe die (Eigentümer Grundstück ###) am 24. Februar 20217 ein Betreten des Grundstücks untersagt. Das habe dazu geführt, dass die Klägerin ihre Geräte nutzlos habe vorhalten müssen. Daher stehe ihr ein Anspruch auf Entschädigung in Höhe von 6.369,45 Euro zu (Bl. 287 d.A.).
Zudem hat die Klägerin die Auffassung vertreten, dass sie für das Fällen von Bäumen mit einem Durchmesser von 0,5-0,75 m, die im Leistungsverzeichnis unstreitig nicht vorgesehen seien, wegen Leistungsänderung gemäß § 2 Abs. 5 VOB/B insgesamt weitere 7.626,64 Euro verlangen könne (Bl. 288 d.A.).
Die Klägerin hat beantragt,
die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 136.363,03 Euro nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. seit dem 2. September 2017 an die Klägerin zu zahlen sowie
die Beklagte darüber hinaus zu verurteilen, an die Klägerin weitere 2.194,90 Euro vorgerichtliche Anwaltskosten nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen.
Die Beklagte hat beantragt,
die Klage abzuweisen.
Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, dass sie der Klägerin nichts mehr schulde. Die klägerische Forderung für die Fällung weiterer “Straßenbäume” bestehe nicht. Die Klägerin habe die Baumfällungen im Untertitel 05.00 “Straßenbäume” mit einem deutlich höheren Einheitspreis als im Untertitel 05.01 “Waldflächen abholzen” angeboten. Die Klägerin habe jedoch nunmehr ohne Berechtigung solche Bäume, die dem Untertitel “Waldflächen” unterfielen, den für die Beklagte deutlich höhere Preise auslösenden “Straßenbäumen” zugeordnet. Dadurch verschiebe sich der Schwerpunkt der Baumfällungen in den Bereich, der keine negativen Einzelpreise aufweise. Damit entferne sich die Klägerin von dem allein maßgeblichen Leistungsverzeichnis. Eine Vergütung über die geprüfte Schlussrechnung hinaus komme daher nicht in Betracht. Darüber hinaus bestreitet die Beklagte, dass die als Straßenbaum abgerechneten Bäume tatsächlich stufenweise abgetragen worden sind.
Zudem habe die Klägerin die streitgegenständlichen Bäume auch ohne Weiteres am Stück fällen können, wenn sie, wie in der Baubeschreibung vorgesehen, beide Fahrspuren gesperrt hätte. Die erforderliche Sperrung der Straße sei kurzfristig jeweils möglich gewesen. Daher seien auch die Ausführungen des Privatgutachters der Klägerin unerheblich, weil eine Vollsperrung ohne Weiteres möglich gewesen wäre.
Das Aufmaß lasse keine Einordnung der aufgemessenen Leistungen zu Positionen des Leistungsverzeichnisses zu, sondern nur über tatsächliche Fragen, wie etwa den Umfang der Bäume. Eine Bestätigung der Einordnung der streitgegenständlichen Bäume als “Straßenbäume” habe die Beklagte auf das Schreiben der Klägerin vom 24. Februar 2017 (K 37, Bl. 599 ff. d.A.) gerade nicht getätigt.
Einen Gemeinkostenausgleich habe die Beklagte bereits vorgenommen, ein weitergehender Zahlungsanspruch bestehe dazu nicht, zumal es dabei lediglich um die spiegelbildliche Nachvollziehung der zu den “Straßenbäumen” von der Klägerin falsch zugeordneten Positionen gehe.
Der Klägerin stehe auch wegen des Grundstücks ### kein weitergehender Anspruch zu, das ab dem 22. Februar 2017 vollständig zugänglich gewesen sei. Im Übrigen werde auch bestritten, dass ein vorheriges Betreten des Grundstücks nicht möglich gewesen sei. Es fehle auch deshalb bereits an den Anspruchsvoraussetzungen dem Grunde nach, da die Klägerin in einem anderen Bereich der Baustelle hätte weiterarbeiten können. Zudem habe die Klägerin per Mail vom 17. Februar 2017 auf die Geltendmachung von Mehrkosten wegen des Grundstücks ### verzichtet (Bl. 544 d.A.). Auch der Höhe nach sei der Anspruch nicht nachvollziehbar begründet.
Hinsichtlich der Baubehinderung beim Grundstück ### stehe der Klägerin schon deshalb kein Anspruch zu, weil nicht ersichtlich sei, dass der Klägerin die geltend gemachten Kosten entstanden sein könnten. Der bloße Verweis auf Anlagen der Klageschrift reiche hierzu nicht aus. Auch habe die Klägerin die Geräte in anderen Bereichen der Baustelle einsetzen können.
Das Erbringen der Leistungen “Fällung von Bäumen mit einem Durchmesser von 0,5-0,75 m” werde nicht in Abrede gestellt. Der Anspruch werde aber über die bereits beglichenen 2.333,07 Euro hinaus der Höhe nach bestritten. Die Beklagte habe 70,02 Euro pro Baum vergütet, weil die Vergütung anhand der Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu erfolgen hatte. Soweit dies in der jüngeren Rechtsprechung teilweise anders gesehen werde und eine Ableitung des Preises nach den tatsächlichen Kosten und nicht nach der Vorkalkulation erfolgen solle (Bl. 622 d.A.), teile die Beklagte diese Auffassung nicht.
Das Landgericht, auf dessen tatsächliche Feststellungen im Übrigen Bezug genommen wird, § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO, hat die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 590,67 Euro zu zahlen und die Klage im Übrigen abgewiesen. Soweit für die Berufung von Bedeutung, hat es seine Entscheidung wie folgt begründet:
Der Klägerin stehe kein Anspruch auf höhere Vergütung für die Fällung der streitgegenständlichen Bäume als sogenannte Straßenbäume in Höhe von noch 89.233,81 Euro zu. Für diese Bäume sei die Fällung zum Einheitspreis für “Waldbäume” vereinbart gewesen, diese sei auch bereits vergütet worden. Der höhere Preis sei im Leistungsverzeichnis nur für Bäume an der Südseite im Bereich der Mulde vereinbart gewesen, das sei für die streitgegenständlichen Bäume nicht der Fall. Die Zuordnung von Bäumen zu den Positionen 05.00 als Straßenbäume ergebe sich auch nicht dadurch, dass die Klägerin diese stufenweise gefällt habe. Die Beklagte habe auch kein abschnittsweises Abtragen der Bäume angeordnet.
Auch § 2 Abs. 5 VOB/B stütze den Anspruch nicht. Die danach erforderliche Änderung des Bauentwurfs habe nicht vorgelegen, da keine Anordnung der Beklagten vorgetragen sei. Soweit die Klägerin geltend mache, die Bäume hätten nicht unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Straßenverkehrs mit nur einem Fällschnitt gefällt werden können, so übersehe sie, dass die Entscheidung, ob der Straßenverkehr unter Inkaufnahme höherer Fällkosten aufrechterhalten werden sollte oder zur Beibehaltung der Kosten auch für einen längeren Zeitraum gesperrt werden würde, der Beklagten oblegen hätte.
Der Anspruch folge auch nicht daraus, dass die Klägerin unterzeichnete Aufmaßblätter vorgelegt habe, in denen bei den streitgegenständlichen Bäumen die Leistungsverzeichnis-Positionen für Straßenbäume eingetragen gewesen seien. Denn das gemeinsame Aufmaß führe nicht dazu, dass die Zuordnung zu einer bestimmten Leistungsposition verbindlich festgelegt werde. Dessen beweisrechtliche Bedeutung erschöpfe sich in tatsächlicher Hinsicht auf den Nachweis erbrachter Massen.
Der Klägerin stehe der geltend gemachte Anspruch auf einen Gemeinkostenausgleich Minder- und Mehrmengen ebenfalls nicht zu. Ein solcher Anspruch würde voraussetzen, dass es zu Mindermengen gekommen sei. Diese berechne die Klägerin daraus, dass aus ihrer Sicht weniger Bäume als Waldbäume abgerechnet werden konnten, weil diese richtigerweise als Straßenbäume abzurechnen gewesen seien. Da die Klägerin mit dieser Auslegung hinsichtlich der Mehrmenge keinen Erfolg habe, bestehe auch keine entscheidungserhebliche Mindermenge.
Ansprüche wegen einer Baubehinderung beim Grundstück ### bestünden nicht. Selbst wenn die Voraussetzungen des § 642 Abs. 1 BGB und § 304 BGB vorliegen sollten, sei eine Schadensschätzung mangels greifbarer Anhaltspunkte nicht möglich.
Auch hinsichtlich vermeintlich fehlender Baufreiheit beim Grundstück ### fehle es an ausreichendem schriftsätzlichen Vortrag dazu, wie sich die geltend gemachten Kosten im Einzelnen zusammensetzten.
Schließlich stehe der Klägerin auch kein Anspruch auf restliche Vergütung von Bäumen mit einem Durchmesser von 0,5 bis 0,75 m in Höhe von 7.626,64 Euro zu. Die Vergütung für Zusatzleistungen bestimme sich gem. § 2 Abs. 6 Nr. 2 Satz 1 VOB / B nach den Grundlagen der Preisermittlung für die vertragliche Leistung und den besonderen Kosten der geforderten Leistung. Zu fragen sei, welchen Maßstab die Parteien zur Bestimmung des neuen Einheitspreises vertraglich zu Grunde gelegt hätten, wenn sie seinerzeit vorhergesehen hätten, dass sie sich nicht auf einen neuen Einheitspreis für die relevanten Mehrmengen einigen können. Danach sei der von der Beklagten zugestandene und gezahlte Einheitspreis von 70,02 Euro nicht zu beanstanden. Die darüber hinaus geforderte Vergütung sei nicht nachvollziehbar. Die Klägerin gehe bei den Kosten für den Bagger mit Spezialschere von Kosten von 345,60 Euro (K 34, Bl. 503 d.A.) für die dickeren Bäume statt 267,80 Euro (Anlage K22, Bl. 475 d.A.) in der Kalkulation für die dünneren Bäume aus und setze einen Zeitaufwand pro Baum von 0,333 Stunden statt 0,05 Stunden an. Diese Ansätze seien jedoch weder plausibel noch sonst erläutert.
Hiergegen richtet sich die Berufung der Klägerin, die ihr erstinstanzliches Begehren mit Ausnahme des Ersatzes erstinstanzlicher ebenfalls geforderter Rechtsanwaltskosten weiterverfolgt.
Der Tatbestand des landgerichtlichen Urteils sei schon angesichts eines unerledigten Tatbestandsberichtigungsverfahrens fehlerhaft. Außerdem habe das Landgericht ein Überraschungsurteil verkündet, da es seine Entscheidung neu und überraschend auf das Fehlen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 5 VOB/B gestützt habe.
Hinsichtlich der Forderung von weiteren 89.233,81 Euro für die Fällung von Straßenbäumen handele es sich entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht um eine irgend geartete Leistungsänderung, sondern allein um den beim Einheitspreisvertrag üblichen Vorgang von Mehrmengen. Entscheidend sei, dass sich die Abrechnungsposition “Straßenbaum” erhöht habe. Der klägerische Anspruch folge aus § 631 BGB. Die Klägerin habe mehrfach die Überschreitung der Mengenansätze des Leistungsverzeichnisses zu Position 05.00 angezeigt. Die tatsächlichen Mengen seien durch die Aufmaße K13-K17 samt der Zuordnung zu den jeweiligen Positionen des Leistungsverzeichnisses nachgewiesen. Diese seien auch hinreichend aussagekräftig, so dass das einfache Bestreiten der Beklagten nicht ausreichend sei.
Auch gehe die Auffassung des Landgerichts fehl, es habe an einer Anordnung zum abschnittsweisen Abtragen der gegenständlichen Bäume gefehlt. Die Arbeiten seien konstant im Beisein von Mitarbeitern der Beklagten erfolgt. Die Arbeiten seien aber auch im vermuteten Einverständnis mit der Beklagten erfolgt, da das stufenweise Abtragen der Bäume – also Behandlung als Straßenbäume – aus Sicherheitsgründen in der Nähe der Straße erforderlich gewesen sei.
Darüber hinaus habe das Landgericht fehlerhaft nicht geprüft, ob eine Vergütung nicht unter GoA-Gesichtspunkten gemäß § 2 Abs. 8 VOB/B zuzusprechen gewesen sei.
Die Klägerin könne auch einen Gemeinkostenausgleich in Höhe von 5.436,88 Euro verlangen. Die Abrechnungsmenge der abschnittsweise abzutragenden Bäume habe sich erhöht und die Abrechnungsmenge der mit einem Fällschnitt zu fällenden Bäume habe sich verringert.
Im Hinblick auf das Grundstück ### seien Voraussetzungen des § 642 BGB erfüllt. Entgegen der Auffassung des Landgerichts fehle es nicht an Vortrag zur konkreten Höhe, insbesondere zu Schadensminderungsbemühungen etwa durch Weg- und Wiederzurückbringen der Geräte anstatt deren nutzlosem Vorhalten auf der Baustelle. Zwar entspreche es ständiger Rechtsprechung, dass ein Unternehmer flexibel auf den Bauverlauf reagieren müsse und gegebenenfalls seine Produktionsmittel von der Baustelle wieder abziehen müsse. Die Klägerin habe jedoch im Einzelnen dargelegt – auch anhand der Vorkalkulation in Anlagen K26-K32, Bl. 488 ff. d.A. -, dass das Wegfahren des Harvesters von der Baustelle deutlich günstiger als dessen Verbleib gewesen sei.
Auch zum Grundstück ### habe die Klägerin entgegen der landgerichtlichen Auffassung mehr als erforderlich zur Höhe der Vorhaltekosten vorgetragen. Sie habe in der Anspruchsbegründung, S. 19, in Verbindung mit der Nachtragskalkulation (K 32, Bl. 499 d.A.) im Einzelnen dargelegt, dass der Arbeitszug sechs Stunden stillgestanden habe. Damit hätten bei den Nachträgen jedenfalls hinreichende Anhaltspunkte für eine Schätzung zur Verfügung gestanden
Hinsichtlich der gefällten Bäume mit einem Durchmesser von 0,5 bis 0,75 m sei unstreitig, dass es sich um eine Zusatzleistung gehandelt habe, also um eine nicht im Leistungsverzeichnis vereinbarte Leistung. Die vom Landgericht herangezogene Entscheidung des BGH (Az. VII 34/18) betreffe dagegen Fälle der Überschreitung des Mengenansatzes und sei daher nicht übertragbar. Auch die weiteren vom Landgericht herangezogenen Entscheidungen beträfen allesamt vorliegend nicht einschlägige Fragen von Mehrmengen. Auch im Übrigen sei die Höhe des Nachtrags durch die Nachtragskalkulation in Anlage K 31 hinreichend belegt. Die Klägerin müsse Gutschriften aus anderen Leistungsverzeichnispositionen nicht in die Kalkulation einfließen lassen. Auch lägen die Voraussetzungen für eine gerichtliche Schätzung ohne Weiteres vor.
Die Klägerin beantragt:
Das Urteil des Landgerichtes Cottbus vom 24. August 2022, Az. 6 O 196/21, wird abgeändert und die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 135.772,36 Euro nebst Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten hieraus über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. seit dem 2. September 2017 zu zahlen.
Die Beklagte beantragt,
die Berufung zurückzuweisen.
Die Beklagte verteidigt das erstinstanzliche Urteil. Das Landgericht habe zutreffend entschieden, dass für die Fällung der gegenständlichen Bäume der Einheitspreis für Waldbäume vereinbart gewesen und dieser bereits beglichen sei. Die Auslegungsbemühungen der Klägerin zum Inhalt des Leistungsverzeichnisses gingen dagegen fehl, wonach es sich dann um Straßenbäume handele, wenn eine Fällung nur durch abschnittsweises Abtragen möglich sei. Dem stehe Nr. 05.00 des Leistungsverzeichnisses entgegen, wonach es sich um Straßenbäume handele, bei denen einzukalkulieren sei, dass Äste teilweise über die Fahrbahn ragten. Daher müssten Straßenbäume in der Nähe einer Straße stehen.
Konkrete Mengenminderungen und Mengenmehrungen habe die Klägerin nicht angezeigt. Die Aufmaße K13-K17 (Bl. 430 ff. d.A.) seien unergiebig, da ihnen keine Aussage dazu entnommen werden könne, ob eine Leistung vertragsgemäß oder einer bestimmten Positionsnummer zuzuordnen sei. Ihnen könne daher kein Anerkenntnis entnommen werden. Auch scheitere ein irgend gearteter Indizwert der Aufmaße daran, dass diese zwar unterzeichnet, aber nicht gemeinsam aufgenommen worden sein. Auch der handschriftliche Vermerk der Beklagten auf einem Schreiben der Klägerin vom 24. Februar 2017 (K 37, Bl. 599 d.A.) habe keine bestätigende Wirkung
Ein Anspruch auf Gemeinkostenausgleich scheitere daran, dass ausweislich der vorstehenden Ausführungen keine Mehr- bzw. Mindermengen angefallen seien.
Das Landgericht habe hinsichtlich des Grundstücks ### zutreffend entschieden, dass es jedenfalls an schlüssigem Vortrag zum Anspruch der Höhe nach fehle. Das Gericht sei auch nicht gehalten, aus Anlagen, die nicht einmal für die hier gegenständlichen Fragen in Bezug genommen worden seien, rechnerische Grundlagen für die Schadensschätzung zusammenzusuchen. Im Übrigen habe die Klägerin jederzeit Ausweicharbeiten an anderen Stellen durchführen können, so dass der Anspruch schon dem Grunde nach nicht bestehe.
Auch hinsichtlich des Grundstücks ### sei jedenfalls der Höhe nach kein Anknüpfungspunkt vorgetragen, der eine Schadensschätzung ermögliche.
Wegen der gefällten Bäume mit einem Durchmesser von 0,5 – 0,75 m handele es sich um zusätzliche Leistungen nach § 2 Abs. 6 VOB/B. Zutreffend habe das Landgericht Cottbus die aus der Entscheidung des BGH (VII ZR 34/18) resultierenden Grundsätze – mithin, dass es beim Fehlen einer vertraglichen Grundlage auf die tatsächlich erforderlichen Kosten ankomme – auch hier angewandt. Dabei sei der Verwertungserlös zu berücksichtigen
II.
Die zulässige Berufung ist unbegründet. Dabei ist unerheblich, dass die vorliegende Sache keine Streitigkeit aus einem Bauvertrag im Sinne von § 72 a Abs. 1 Nr. 2 GVG darstellt, so dass auch erstinstanzlich keine Zuständigkeit der den Rechtsstreit entscheidenden Baukammer begründet war. Denn Baumfällarbeiten sind keine Bauarbeiten und zwar auch dann nicht, wenn sie wie vorliegend mit Rodungsarbeiten einhergehen (OLG Brandenburg, Beschluss vom 10. September 2021 – 1 AR 37/21 (SA Z). Allerdings haben die Parteien diesen Umstand nicht gerügt und zudem bedeuten Fehler bei der Anwendung des Geschäftsverteilungsplanes grundsätzlich nur einen Eingriff in das Prozessgrundrecht auf den gesetzlichen Richter, wenn sie auf Willkür beruhen, also eine Zuständigkeitsentscheidung objektiv nicht mehr verständlich und offensichtlich unhaltbar ist (OLG Dresden, Urteil vom 11. Februar 2020 – 4 U 1676/19 -). Hierfür ist nichts ersichtlich.
Die Berufung ist unbegründet, weil das Landgericht die zum Gegenstand des Berufungsverfahrens gemachten Ansprüche zu Recht abgewiesen hat.
1. Das Landgericht hat zu Recht einen Anspruch der Klägerin auf Zahlung weiterer 89.233,81 Euro verneint.
a) Dabei gehen die Parteien ohne Weiteres davon aus, dass die VOB/B tatsächlich vereinbart worden ist. Eine ausdrückliche Vereinbarung lässt sich den vorgelegten Vertragsunterlagen allerdings nicht entnehmen. Ob die ausdrückliche Vereinbarung an anderer Stelle der nicht vollständig vorgelegten Vergabeunterlagen enthalten ist, kann aber offenbleiben. Denn die vereinbarten ZVB/E-StB sehen Konkretisierungen der VOB/B vor (Bl. 360, 364 d.A.) und beziehen sich ausdrücklich auf eine Vielzahl von Regelungen der VOB/B. Auch die Besonderen Vertragsbedingungen (Bl. 369 d.A.) nehmen immer wieder Bezug auf Regelungen der VOB/B. Das lässt bei den Parteien als Fachleuten die Annahme zu, dass die VOB/B insgesamt vereinbart ist. Bei bewanderten Vertragspartnern genügt für eine Einbeziehung der VOB/B deren bloße Inbezugnahme, etwa im Vertragstext. Dies gilt auch für juristische Personen des öffentlichen Rechts (Motzke/Bauer/Seewald, Prozesse in Bausachen, Rn. 136, beck-online). Dabei findet vorliegend die VOB/B Fassung 2016 Anwendung (nachfolgend VOB/B).
Zwar kann die VOB/B regelmäßig nur in Verträge einbezogen werden, die Bauleistungen im Sinne von § 1 VOB/A betreffen (OLG Nürnberg, Urteil vom 11. Oktober 2005 – 9 U 804/05 -). Der 1. Senat des OLG Brandenburg hat wiederum den Begriff des Bauvertrags im Sinne von § 72a Abs. 1 Nr. 2 GVG so ausgelegt, dass die vertragliche Verpflichtung zur Durchführung von Baumfäll- und Rodungsarbeiten auf einem Baufeld zur Vorbereitung von Baumaßnahmen nicht als ein solcher Bauvertrag einzuordnen ist. Ein Vertrag, der die Erbringung von Leistungen zum Gegenstand hat, die lediglich dazu dienen, ein Grundstück zur Bebauung freizumachen, stelle – noch – keinen Bauvertrag dar (OLG Brandenburg, Beschluss vom 10. September 2021 – 1 AR 37/21 (SA Z) -; vgl. auch BGH, Beschluss vom 24. Februar 2005 – VII ZR 86/04 -). Nichts anderes ist hier maßgeblich, weil auch vorliegend Baumfäll- und Rodungsarbeiten allein zur Baufeldfreimachung beauftragt sind.
Allerdings muss auch berücksichtigt werden, dass der hier maßgebliche Begriff der Bauleistungen gemäß § 1 VOB/A – synonym zum Begriff des Bauauftrags nach § 103 Abs. 3 GWB (vgl. Pünder/Schellenberg, Vergaberecht, VOB/A § 1 Rn. 2, beck-online; Hofmann/Lausen in: Heiermann/Zeiss/Summa, jurisPK-Vergaberecht, 6. Aufl., § 1 VOB/A (Stand: 15.09.2022), Rn. 9) – Arbeiten jeder Art umfasst, durch die eine bauliche Anlage hergestellt, instand gehalten, geändert oder beseitigt wird. Das erfasst alle Arbeiten an einem Grundstück, wie z.B. Garten- und Landschaftsgestaltung, das Nachziehen eines Bachbettes, Ausschachtungsarbeiten, Aufschüttung und Dränagen, auch soweit sie nicht der Errichtung eines Hauses oder sonstigen Bauwerks dienen (Kapellmann/Messerschmidt/Lederer, 8. Aufl. 2023, VOB/A § 1 Rn. 12; vgl. “sonstige Baugrundarbeiten” Hofmann/Lausen in: Heiermann/Zeiss/Summa, jurisPK-Vergaberecht, 6. Aufl., § 1 VOB/A (Stand: 15.09.2022), Rn. 73).
Solche Arbeiten an einem Grundstück sind auch vorliegend betroffen. Zwar handelt es sich nicht um Garten- und Landschaftsgestaltung, weil die Baumfällarbeiten der Errichtung einer Straße dienen. Gleichwohl führen die Fäll- und Rodungsarbeiten dazu, dass ein der Errichtung einer baulichen Anlage – der Straße – dienendes Grundstück durch Ausschachtungen und Aufschüttungen vorbereitet wird. Der daraus ersichtliche Bezug zu Bauleistungen lässt es jedenfalls als gerechtfertigt erscheinen, dass die Parteien für diese Leistungen die Einbeziehung der VOB/B vereinbaren konnten. Im Einklang damit hat auch der Bundesgerichtshof im Rahmen eines Vertrags über Baumfäll- und Rodungsarbeiten die VOB/B ausdrücklich als einbezogen erachtet (vgl. BGH, Urteil vom 10. Juni 2021 – VII ZR 157/20 -), was grundsätzlich nur möglich ist, wenn es sich dabei um Bauleistungen nach § 1 VOB/A handelt.
b) Der Klägerin steht der geltend gemachte Restwerklohnanspruch aus dem Bauvertrag in Verbindung mit § 631 Abs. 1 BGB iVm § 2 Abs. 3 VOB/B nicht zu. Die besonderen Voraussetzungen der VOB/B über Schlussrechnung und Widerspruch gemäß § 16 Nr. 3 Abs. 5 VOB/B sind durch Schreiben vom 21. August 2017 (K 11 Bl. 76 d.A.) erfüllt. Entscheidend ist vorliegend die Auslegung der vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich der Frage, ob ein Straßenbaum im Sinne des Leistungsverzeichnisses dann vorliegt, wenn er infolge Nähe zur Straße stufenweise gefällt werden muss – so die Klägerin – oder ob ein Straßenbaum – so das Landgericht – nur dann vorliegt, wenn er in einer Mulde südlich der Straße entlang eines Amphibien- und Reptilienschutzzaun zu fällen war. Die Auslegung ergibt, dass Straßenbäume nur am Amphibien- und Reptilienschutzzaun vorgesehen waren.
Soweit die Klägerin dabei in der mündlichen Verhandlung vor dem Senat die dort unter “Straßenbaum” und “Waldbaum” erfolgte Differenzierung der Abrechnungspositionen als nicht vertragskonform gerügt hat, hält der Senat daran weiter fest. Denn der Begriff “Straßenbaum” wird in Pos. 05.00 des Leistungsverzeichnisses ausdrücklich genutzt und in der Pos 05.01 ist ausdrücklich von “Waldflächen abholzen” sowie in der Baubeschreibung unter 3.1.2. von “Waldbäumen” die Rede. Hinzu kommt, dass auch die Klägerin selbst in nahezu sämtlichen Schriftsätzen ausdrücklich die Begriffe “Straßenbaum” und “Waldbaum” genutzt hat, um die gegenständlichen Abrechnungspositionen abzugrenzen (so etwa Bl. 573 d.A.).
Allerdings spricht zunächst einiges für die Auffassung der Klägerin, wonach die Parteien mit Pos. 05.00 “Straßenbäume fällen”, die Abrechnung von solchen Bäumen vereinbart haben, die infolge der Nähe zur Straße ein “stufenweises” Fällen erfordern. Denn in den Unterpositionen 05.00.0001-0006 (Straßenbaum) ist jeweils vorgesehen, dass der Stamm stufenweise abgetragen werden soll. Dementsprechend könnte die Position 05.01 “Waldflächen abholzen” so ausgelegt werden, dass sie die Abholzung von Bäumen erfasst, die mangels Nähe zur Straße nicht stufenweise abgetragen werden müssen. Diese Auslegung wird gestützt durch Ziffer 1.1.1.8 der Baubeschreibung (Bl. 310 d.A.), wonach die “zu fällenden Bäume durch” Stammdurchmesser, Baumart und Art der Nachnutzung unterschieden werden. Da die Waldbäume in einem Schnitt gefällt werden, können sie noch im Sinne der vorstehenden Regelung nachgenutzt werden. Die Nähe von Bäumen zu einer Mulde wird dort gerade nicht erwähnt.
Dabei stellt sich allerdings die Frage, nach welchen Kriterien zu ermitteln sein soll, ob es sich bei dem jeweils abgerechneten Baum um einen Straßenbaum oder einen Waldbaum handelt. Dem Leistungsverzeichnis lassen sich ebenso wenig wie den weiteren Vertragsunterlagen abstrakte Kriterien – etwa Entfernung zur Straße in Metern – finden, die eine Einordnung als Straßenbaum oder als Waldbaum gestatten könnten. Naheliegend dürfte es zwar sein, Straßenbäume als solche anzusehen, die infolge der Nähe zur Straße ein “stufenweises” Fällen erfordern.
Allerdings ist die Frage, wann ein stufenweises Fällen erforderlich ist, bei den streitgegenständlichen Vertragsunterlagen nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten ermittelbar. Denn in den Positionen 03.01.0001 und 0002 des Leistungsverzeichnisses (Bl. 343 d.A.) ist für die Verkehrssicherung an Arbeitsstellen kürzerer Dauer, das Aufstellen einer Lichtsignalanlage als Leistung der Klägerin vorgesehen. In der Baubeschreibung heißt es dazu, unter 03.01.0002 “Diese Anlage ist kurzfristig auf “Rot-Rot-Betrieb” zu schalten, bei Fällarbeiten in dem unmittelbar angrenzenden Straßenseitenraum”. Das könnte so verstanden werden, dass die Klägerin selber bestimmen kann, ob nahe an der Straße stehende Bäume Straßen- oder Waldbäume sind. Wenn die Klägerin nämlich die Straße mittels Lichtzeichenanlage während des Fällvorgangs kurzfristig sperrt, dann dürfte es ihr ohne weiteres möglich sein, auch einen nah an der Straße stehenden Baum mit einem Schnitt zu fällen – und ihn damit quasi zum abzurechnenden Waldbaum zu machen. Oder eben anders herum – so wie es auch vorliegend geschehen ist – sie nimmt nicht immer Sperrungen vor und kann dann die stufenweise gefällten Bäume als Straßenbäume abrechnen, obwohl dies möglicherweise nicht der Intention der Beklagten bei der Ausschreibung entspricht.
Gegen die vorstehende Auslegung spricht daher die Beliebigkeit, mit der der Klägerin dann die Zuordnung zu “Straßenbäumen” oder “Waldbäumen” bestimmen könnte. Denn so könnte die Klägerin entscheiden, ob sie die Straße sperrt oder nicht, und so entweder Bäume als Straßen- oder als Waldbäume fällen. Dann hätte sie auch direkten Einfluss darauf, welche Vergütung für den jeweiligen Baum gefordert werden könnte. Ein derartiges Auslegungsergebnis erscheint auch aus der maßgeblichen Sicht eines Bieters, insbesondere vor dem Hintergrund der aus § 7 BHO folgenden Verpflichtung der Beklagten zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, fernliegend. Andernfalls stünde der Klägerin ein einseitiges Bestimmungsrecht über die Zuordnung von Bäumen zu Positionen des Leistungsverzeichnisses zu, mit dem sie selbst bestimmen könnte, in welcher Höhe sie zu vergüten ist.
Hinzu kommen die ausdrücklichen Regelungen des Leistungsverzeichnisses und der Baubeschreibung. Danach sollen die streitgegenständlichen Bäume als Waldbäume einzuordnen sein, weil in dem Leistungsverzeichnis ein höherer Einheitspreis für Straßenbäume nur für solche Bäume vereinbart wurde, die an der Südseite im Bereich der Mulde für die spätere Anlage eines Amphibienschutzzaunes standen. Denn in der der Vorbemerkung zu Position 05.00 “Straßenbäume” fällen, heißt es:
“Fällung Südseite im Bereich der Mulde für die spätere Anlage eines Amphibienschutzzaunes”.
Das wird konkretisiert unter Ziffer 1.1.1.8 der Baubeschreibung (Bl. 311 d.A.):
“Dazu kommen Straßenbäume, die für die Anlage eines Amphibien- und Reptilienschutzzaunes gefällt werden müssen. Dies sind ca. 160 Bäume mit einem Durchmesser bis zu 30 cm und ca. 50 Bäume mit einem Durchmesser von 30 cm bis 50 cm. Die Details sind den entsprechenden Leistungspositionen zu entnehmen”.
Dafür, dass die vorstehend erwähnten 210 (160 + 50) Straßenbäume am Amphibien- und Reptilienschutzzaun im Wesentlichen die Bäume sind, die das Leistungsverzeichnis als Straßenbäume in den Positionen 05.00.0001-0006 vorsieht, spricht zudem, dass in diesen Positionen des Leistungsverzeichnisses 207 Straßenbäume erwähnt werden – das entspricht im Wesentlichen den 210 Straßenbäumen aus dem vorstehenden Abschnitt der Baubeschreibung. Damit sprechen auch die Mengenansätze – knapp 210 – der Position “Straßenbäume” in den Positionen zu 05.00 des Leistungsverzeichnisses sowie die 210 Straßenbäume in der Ziffer 1.1.1.8 der Baubeschreibung dafür, dass die beauftragten Fällungen der Straßenbäume die Bäume betreffen, die gemäß Position 05.00 des Leistungsverzeichnisses und Ziffer 1.1.1.8 der Baubeschreibung im Bereich der Mulde stehen. Diesem Ergebnis steht angesichts der andernfalls auftretenden Unwägbarkeiten – etwa bei vorstehend aufgezeigten Frage, wer andernfalls und nach welchen genauen Kriterien vor Ort die Einordnung als Straßen- oder Waldbaum vornehmen sollte – auch mit dem Sinn und Zweck der vertraglichen Bestimmungen im Einklang.
Schließlich hat der Senat auch berücksichtigt, dass es bei der Auslegung von Leistungsbeschreibungen in öffentlichen Ausschreibungen insbesondere auch darauf ankommt, ob die verwendete Formulierung von den angesprochenen Fachleuten in einem spezifischen, technischen Sinn verstanden wird oder in den maßgeblichen Fachkreisen verkehrsüblich ist (BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 – VII ZR 10/01 -; BGH, Urteil vom 23. Juni 1994 – VII ZR 163/93 -). Aber auch hierfür ist im Sinne der von der Klägerin bemühten Auslegung nichts vorgetragen oder ersichtlich. Schließlich war auch zu berücksichtigen, dass Leistungsbeschreibungen in öffentlichen Ausschreibungen regelmäßig nicht aus Sicht des Auftraggebers, sondern aus Sicht der möglichen Bieter als Empfängerkreis auszulegen sind (vgl. BGH, Urteil vom 22. April 1993 – VII ZR 118/92). Auch insoweit sind jedoch keine Umstände vorgetragen oder ersichtlich, die aus Sicht potentieller Bieter eine Auslegung gegen den klaren Wortlaut und die eindeutige Systematik gebieten könnte.
Angesichts dieser in der Gesamtschau eindeutigen Regelungen des Leistungsverzeichnisses verbleibt kein Zweifel daran, dass die Parteien vereinbart haben, dass Straßenbäume solche Bäume sind, die für die Anlage des Amphibien- und Reptilienschutzzaunes zu fällen waren. Damit verbleibt kein Raum für die ohne Anknüpfungspunkt in den Vertragsunterlagen bleibende Auslegung der Klägerin, wonach Straßenbäume solche seien, die durch mehrere Schnitte gefällt worden sind. Das gilt umso mehr, als im Hinblick auf die klaren und eindeutigen Regelungen der Baubeschreibung und des Leistungsverzeichnisses umso gewichtigere Anhaltspunkte vorliegen müssten, um die – unzutreffende – Auffassung der Klägerin zu stützen. Solche Anhaltspunkte sind erst recht nicht vorgetragen oder ersichtlich.
c) Der geltend gemachte Werklohnanspruch folgt auch nicht aus § 631 BGB in Verbindung mit den Aufmaßblättern. Die Bindungswirkung des Aufmaßes geht, sofern ein weitergehender Willen der Parteien im konkreten Fall nicht ausnahmsweise feststellbar ist, nicht über die Feststellung des Umfangs der erbrachten Leistung hinaus.
aa) Nach dem Zweck des Aufmaßes – der bloßen Tatsachenfeststellung – gilt die Bindungswirkung nur für den Umfang der vom Auftragnehmer tatsächlich erbrachten Leistungen, nicht aber auch für ihre Vergütungspflicht. Mit dem gemeinsamen Aufmaß ist regelmäßig nicht zugleich die Feststellung verbunden, dass und wie die Leistung abgerechnet und vergütet wird und ob sie vertragsgemäß ist (BGH, Urteil vom 24. Januar 1974 – VII ZR 73/73 -; Kleine-Möller/Merl/Glöckner, PrivBauR-HdB, § 12,). Die beweisrechtliche Wirkung des Aufmaßes besteht daher grundsätzlich nur in tatsächlicher Hinsicht. Dem Auftraggeber ist es trotz des gemeinsam genommenen Aufmaßes unbenommen, gegen die Vergütungsforderung einzuwenden, die Leistung sei bereits von einer anderen Position des Leistungsverzeichnisses umfasst, oder sie dürfe nach den vertraglichen Vereinbarungen gar nicht bzw. nicht in dieser Weise abgerechnet werden (Ingenstau/Korbion, § 14 Abs. 2 VOB/B, Rn. 10; BeckOK VOB/B/Cramer, 50. Ed. 31.1.2023, VOB/B § 14 Abs. 2 Rn. 11). Durch ein gemeinsames Aufmaß ist also der Einwand nicht abgeschnitten, die Leistung sei von einer anderen Position miterfasst, sei nach den Vereinbarungen nicht berechenbar, bei richtiger Vertragsauslegung anders zu berechnen oder sei überhaupt nicht vertraglich vereinbart. Einwendungen dieser Art werden von vorneherein nicht vom Zweck eines Aufmaßes erfasst, tatsächliche Verhältnisse festzustellen und Beweisschwierigkeiten insoweit zu verhüten. Sie können deshalb dadurch auch nicht präkludiert werden (BGH, Urteil vom 30. Januar 1992 – VII ZR 237/90 -; BGH, Urteil vom 24. Januar 1974 – VII ZR 73/73; OLG Karlsruhe, Urteil vom 28. Dezember 2001 – 7 U 299/97 -, Rn. 129).
Damit fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, dass der geltende gemachte Anspruch auf die gegenständlichen Aufmaßblätter gestützt werden könnte. Denn die Klägerin hat keinen Umstand vorgebracht, der ein Abweichen von den vorstehend aufgezeigten Grundsätzen rechtfertigen könnte. Es ist insbesondere nicht vorgetragen oder ersichtlich, dass die Parteien durch die Angabe der Position des Leistungsverzeichnisses und der jeweiligen Kurzbeschreibung auf den Aufmaßblättern über eine ordnende Funktion hinaus mit Rechtsbindungswillen die bindende Zuordnung zu einer Position des Leistungsverzeichnisses vornehmen wollten. Der Umstand, dass die Beklagte die gegenständlichen Aufmaßblätter vorgegeben hat, auf denen Eintragungsfelder für die jeweils betroffene Position des Leistungsverzeichnisses vorgesehen sind, lässt ebenfalls keinen Rückschluss darauf zu, dass die Bindungswirkung des Aufmaßes sich auf die Zuordnung zu Leistungspositionen erstrecken soll. Denn die von der Beklagten vorgesehenen Aufmaßblätter sind dem Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauarbeiten im Straßen- und Brückenbau (HVA-B-StB) als Muster entnommen und kommen daher in einer Vielzahl von Verträgen zur Anwendung. Die Annahme, dass in all diesen Verträgen vom Grundsatz abgewichen werden soll, dass das Aufmaß nur den Umfang der erbrachten Leistung dokumentieren soll, liegt daher fern. Erst recht ist ein solcher Umstand nicht im Hinblick auf den gegenständlichen Vertrag vorgetragen oder sonst ersichtlich.
bb) Soweit sich die Klägerin auf ihr Schreiben vom 24. Februar 2017 (K 37, Bl. 599 d.A.) beruft, auf dem sich handschriftliche Anmerkungen – wohl eines Mitarbeiters der Beklagten, Herrn ###, – finden, ist auch insoweit kein anderes Ergebnis begründbar. Dort heißt es:
“Die Bäume auf der Nord- und Südseite werden gemäß Titel 05.00 [Straßenbäume …] durchgeführt. Die gemeinsam aufgemessenen Mengen in den Leistungsverzeichnis-Positionen des Titels 05.00 bilden dabei die Abrechnungsgrundlage.”
Der anschließend geäußerten Bitte um Bestätigung hat der Mitarbeiter der Beklagten in seiner handschriftlichen Anmerkung auf diesem Schreiben entgegen der Auffassung der Klägerin aber nicht entsprochen. Vielmehr hat er ausgeführt, wie die gefällten Bäume gelagert werden sollen und dies mit der einleitenden Bemerkung “Unter folgender Bedingung” versehen. Eine ausdrückliche Zustimmung zu den klägerischen Ausführungen ist damit nicht verbunden. Es liegen aber auch die erforderlichen Anhaltspunkte für die Annahme einer konkludenten Zustimmung zu der von der Klägerin vertretenen Auffassung nicht vor. So ist im Hinblick auf die Höhe der klägerseits geltend gemachten Forderungen von zunächst über 700.000 Euro ersichtlich eine Entscheidung vom Mitarbeiter der Beklagten abverlangt, die eine erhebliche wirtschaftliche Tragweite auswies und überdies nach den vorstehenden Ausführungen zu einer Änderung des Vertrags geführt hätte. An die Annahme einer konkludenten Zustimmung sind daher hohe Anforderungen zu stellen.
Ungeachtet der Frage, ob der Mitarbeiter der Beklagten insoweit überhaupt vertretungsbefugt war, hätten daher auch aus Sicht der Klägerin eindeutige Anhaltspunkte für eine Zustimmung des Mitarbeiters der Beklagten vorliegen müssen. Das Gegenteil war der Fall, weil der Mitarbeiter der Beklagten lediglich mit Anmerkungen über den Lagerplatz einzelner Bäume geantwortet hat. Hinzu kommt, dass ein lebensnah nachvollziehbarer Grund für diese handschriftliche Anmerkung von der Beklagten vorgebracht ist. Denn nach der eingangs in den tatsächlichen Feststellungen angeführten Entscheidung des BGH mit dem Az. VII ZR 157/20 sei es der Klägerin nicht mehr möglich gewesen, Mindermengen für Holzerlöse geltend zu machen und in der Folge seien von der Klägerin mehrfach Entsorgungskosten geltend gemacht worden. Dem habe der Mitarbeiter der Beklagten mit seiner handschriftlichen Notiz, wonach eine Lagerung auf dem Baufeld erfolgen sollen, entgegenwirken wollen (Bl. 618 d.A.). In der Gesamtschau liegen damit die erforderlichen eindeutigen Anhaltspunkte für die behauptete Vereinbarung der Klägerin mit dem Mitarbeiter der Beklagten, Herrn ###, nicht vor. Angesichts der voranstehenden Ausführungen kann offenbleiben, ob die vermeintliche Vereinbarung nicht ohnehin nur für die Zukunft gelten und nicht die schon zurückliegenden Fällungen erfassen sollte.
cc) Ebenso wenig ergibt sich eine weitergehende Bindungswirkung des Aufmaßes aus dem vorgelegten Bautagebuch vom 16. Februar 2017 (K 39, Bl 688). Denn allein der Umstand, dass dort ein Hr. ### – ein Mitarbeiter des externen Bauüberwachers – am Aufmaß teilgenommen hat und das “Abtragen der Bäume” erörtert worden sein soll, sagt nichts darüber aus, ob der Angabe der Positionsnummer des Leistungsverzeichnisses in den Aufmaßblättern Bindungswirkung zukommt. Hinzu kommt, dass die darlegungs- und beweisbelastete Klägerin keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen hat, dass Herr ### zur Vereinbarung von Leistungsänderungen im Namen der Beklagten bevollmächtigt war oder die Voraussetzungen einer Duldungs- oder Anscheinsvollmacht vorgelegen haben könnten (vgl. hierzu OLG Brandenburg, Beschluss vom 2. Juni 2021 – 11 U 226/20 -).
d) Ein Vergütungsanspruch nach §§ 631 BGB, 2 Abs. 5 VOB/B steht der Klägerin ebenfalls nicht zu. § 2 Abs. 5 VOB/B sieht vor, dass ein neuer Preis unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu vereinbaren ist, wenn durch Änderung des Bauentwurfs oder andere Anordnungen des Auftraggebers die Grundlagen des Preises für eine im Vertrag vorgesehene Leistung geändert werden.
Eine Änderung des Bauentwurfs im Sinne dieser Vorschrift ist nicht erfolgt. Eine Änderung des Bauentwurfs liegt nur dann vor, wenn etwas anderes als das ursprünglich Vorgesehene vom Auftragnehmer geleistet werden soll. Das ist nicht der Fall, weil im Leistungsverzeichnis die Aufteilung zwischen Wald- und Straßenbäumen vereinbart war (siehe hierzu oben unter Gliederungspunkt 1 b)
Es liegt auch keine Anordnung der Beklagten im Sinne dieser Vorschrift vor. Eine solche Anordnung ist nach dem bis zum 31. Dezember 2017 gegebenen Rechtsstand grundsätzlich formlos möglich und kann daher auch stillschweigend und konkludent erfolgen (BeckOK VOB/B/Kandel, 50. Ed. 31.10.2022, VOB/B § 2 Abs. 5 Rn. 54). Es ist jedoch weder vorgetragen noch sonst ersichtlich, worin vorliegend eine stillschweigende Anordnung zu sehen sein soll. Sofern die Klägerin vorbringt, Mitarbeiter der Beklagten seien konstant auf der Baustelle anwesend gewesen und hätten den Fällungen zugestimmt, folgt daraus nicht mit der erforderlichen Sicherheit, dass eine die vertraglichen Grundlagen ändernde Erklärung abgegeben werden sollte. Zudem scheidet eine solche Anordnung regelmäßig aus, wenn der Auftraggeber erkennbar der Auffassung ist, die Leistung sei bereits vertraglich geschuldet (BeckOK VOB/B/Kandel, 50. Ed. 31.10.2022, VOB/B § 2 Abs. 5 Rn. 54). Das ist auch vorliegend der Fall.
e) Auch aus § 2 Abs. 6 VOB/B folgt kein Anspruch der Klägerin. Diese Vorschrift berechtigt den Auftragnehmer zur Forderung einer besonderen Vergütung, wenn eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung gefordert wird. Soweit danach eine Leistung so wie vorliegend von vornherein vom Auftragnehmer geschuldet ist, liegt bereits begrifflich keine solche Leistungsänderung vor (BeckOK VOB/B/Kandel, 50. Ed. 31.10.2022, VOB/B § 2 Abs. 6 Rn. 18).
f) § 2 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B sieht vor, dass der Auftraggeber solche ohne Auftrag ausgeführten Leistungen zu vergüten hat, wenn er sie nachträglich anerkennt. Anhaltspunkte für ein solches Anerkenntnis sind nicht ersichtlich.
g) Auch nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 3, §§ 683 Satz 1, 670 BGB steht der Klägerin kein Zahlungsanspruch zu.
Ein Ausspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag steht nicht erkennbar mit dem mutmaßlichen Willen der Beklagten in Einklang. Es ist vorliegend nicht ersichtlich und nicht vorgetragen, dass die stufenweise erfolgenden Fällungen dem Willen der Beklagten entsprachen, weil sie die Leistung ausweislich des Leistungsverzeichnisses gerade anders vereinbart hat – nämlich das Fällen von Straßenbäumen stufenweise nur im Bereich der Mulde – als die Klägerin nunmehr abrechnet. Wenn die Beklagte die Leistung dergestalt ausgeschrieben hat, dass an Mulde / Amphibienzaun Straßenbäume abschnittsweise zu fällen waren, dann spricht schon die damit einhergehende Gestaltung der Preisstruktur dafür, dass sie die abschnittsweise Fällung (=Straßenbäume) an anderer Stelle nicht wollte.
Es ist auch nicht ersichtlich oder sonst vorgetragen, dass die abschnittsweise Fällung an anderer Stelle als der vertraglich vereinbarten Stelle an Mulde / Amphibienzaun erforderlich war. Soweit die Klägerin hierzu ausführt, dass ohne die abschnittsweise Fällung der Bäume, ein Betrieb der Bundesstraße nicht möglich gewesen sei, greift das nicht. Insbesondere hätte es der Klägerin offen gestanden, die Straße kurzzeitig vollständig oder teilweise zu sperren, wenn ein an der Straße stehender “Waldbaum” zu fällen war. Zwar findet sich hierzu in einem von der Klägerin vorgelegten Zeitungsartikel (Bl. 180 d.A.) die Aussage, dass eine Sperrung der Straße nur halbseitig möglich gewesen sei. In den Ausschreibungsunterlagen findet sich eine derartige Einschränkung aber nicht. Vielmehr heißt es dort ausdrücklich hinsichtlich der Lichtsignalanlage unter Ziffer 3.1.2 Absatz 5: “Diese Anlage ist bei Bedarf kurzzeitig auf “Rot-Rot-Betrieb” zu schalten, wenn Fällarbeiten in dem unmittelbar angrenzenden Straßenseitenraum vorgenommen worden”
Die Klägerin beruft sich darüber hinaus auf ein von ihr vorgelegtes Privatgutachten ### vom 22. Februar 2017 (K 35, Bl. 580 ff. d.A.). Danach sei bei einer Vielzahl von Bäumen aufgrund der Nähe zur Straße nur ein stufenweises Abtragen zulässig gewesen und daher eine Abrechnung als Straßenbaum erforderlich. So sehe es auch die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (K 36, Bl. 596 d.A.) vor. Aber auch insoweit ist nicht ersichtlich, warum die Klägerin nicht von der Möglichkeit Gebrauch gemacht hat, die Straße für den Moment der Fällung kurzfristig in dem in den Vertragsunterlagen ausdrücklich zugelassenen “Rot-Rot-Betrieb” zu sperren. Zwar führt der Privatgutachter aus, dass derart viele Bäume in Straßennähe gefällt werden mussten, dass das nur durch eine durchgängige Sperrung der Straße zu bewältigen gewesen wäre (Bl. 585 d.A.), wenn die Bäume als Waldbäume durch einen Schnitt zu fällen gewesen wären. Für diese Wertung spricht zunächst auch das Vorbringen der Klägerin, wonach im Leistungsverzeichnis Pos. 03.01.0003 ein Vorhalten der Ampelanlage nur für 10 Tage geplant gewesen sei, sie diese tatsächlich nur für 13 Tage abgerechnet habe und die Bauarbeiten dagegen vom 13. Februar 2017 bis zum 19. April 2017, also zwei Monate gedauert hätten. Das könnte zunächst darauf hindeuten, dass die kurzzeitige Straßensperrung der Ausnahmefall bleiben sollte. Was die Klägerin bei ihrer Angabe einer Dauer ihrer Arbeiten von “2 Monaten” ausspart, ist der Umstand, dass nach ihrer eigenen Darstellung schon am 21. Februar 2017 alle mit Harvester durchzuführenden Leistungen abgeschlossen waren (K 38, Bl. 600 d.A.) und im Übrigen alle Baumfällarbeiten wegen der Vogelschutzzeit Ende Februar abgeschlossen sein mussten. Daher ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass Baumfällarbeiten von mehreren Monaten erforderlich waren. Darüber hinaus ist die Klägerin selbst davon ausgegangen, dass sie Sperrungen der B101 für die Baumfällungen vorzunehmen hat. So hat sie in ihrem Schreiben vom 24. Februar 2017 selbst ausgeführt, dass die Baumfällungen unter Beachtung “der Sperrung gemäß Titel 03. durchgeführt” werden (K 37, Bl. 599 d.A.). In Titel 3 des Leistungsverzeichnisses ist wiederum vorgesehen, dass für Fällarbeiten neben der Straße eine Absperrung des Straßenbereichs der B101 erfolgen kann (Bl. 198 d.A).
h) Eine Vergütung steht dem Auftragnehmer gemäß § 2 Abs. 8 Nr. 2 S. 2 VOB/B ferner zu, wenn die Leistungen für die Erfüllung des Vertrags notwendig waren, dem mutmaßlichen Willen des Auftraggebers entsprachen und ihm unverzüglich angezeigt wurden. Es fehlte aber nach den vorstehenden Ausführungen unter Gliederungspunkt f) schon daran, dass die Leistungen dem mutmaßlichen Willen der Beklagten entsprachen.
i) Ein Bereicherungsanspruch besteht für die Klägerin ebenfalls nicht, weder aus § 812 Abs. 1 Satz 1, 1. Alt. (Leistung) BGB noch aus § 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Alt. BGB (conditio ob rem) oder aus § 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. BGB (Nichtleistungskondiktion). Denn ein Rechtsgrund folgt aus dem bestehenden Vertrag, der wie festgestellt die gegenständlichen Leistungen umfasst. Zudem stünden die Grundsätze der sog. aufgedrängten Bereicherung einem derartigen Anspruch entgegen, denn durch das Bereicherungsrecht dürfen vorrangige vertragliche Regelungen des privaten Baurechts nicht umgangen werden (OLG Düsseldorf, Urteil vom 21. November 2014 – 22 U 37/14 -; siehe auch OLG Düsseldorf, Urteil vom 25. Oktober 2013 – 22 U 21/13 -).
j) Ein Zahlungsanspruch ergibt sich auch nicht aus § 631 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Treu und Glauben gemäß § 242 BGB. Zwar kann sich ein Vergütungsanspruch des Auftragnehmers unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben ergeben, wenn ein Auftraggeber Vertragsänderungen oder Anordnungen verweigert, obwohl die Leistungsbeschreibung unzureichend ist (Ingenstau/Korbion, § 1 Abs. 3 VOB/B, Rn. 22). Hierfür müsste jedoch ersichtlich sein, dass die vereinbarte Leistungsausführung – das abschnittsweise Fällen von Straßenbäumen am geplanten Amphibienzaun, im Übrigen das Fällen von Waldbäumen in einem Schnitt – unzureichend war. Das ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil die Klägerin die Möglichkeit vorübergehender Straßensperrungen im Zeitpunkt des Fällens eines Baumes in Straßennähe offenstand. Weshalb dennoch ein Fällen der Bäume, so wie vereinbart nicht möglich gewesen sein soll, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
k) Der Klägerin steht danach unter keinem rechtlichen Grund ein Anspruch auf Zahlung von 89.233,81 Euro für die Fällung von “Straßenbäumen” zu.
2. Der geltend gemachte Anspruch auf Gemeinkostenausgleich in Höhe von 5.436,88 Euro scheitert daran, dass nach den vorstehenden Ausführungen unter Gliederungspunkt 1. keine Mehr- bzw. Mindermengen angefallen sind.
3. Der Klägerin steht der geltend gemachte Anspruch auf Zahlung von 5.333,24 Euro, weil das (“Eigentümer des Grundstücks ###”) nicht rechtzeitig für die Fällarbeiten zur Verfügung gestellt worden sei, unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.
a) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer gemäß § 642 BGB iVm § 6 Abs. 6 S. 2 VOB/B, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Voraussetzungen dieser Regelungen sind nicht erfüllt.
aa) Dabei kann der Senat offenlassen, ob die Voraussetzungen des § 642 BGB dem Grunde nach erfüllt sind und ob die unter Schadensminderungsgesichtspunkten geltend gemachten Kosten für die Verbringung der Geräte zum Einsatz an anderer Stelle nach dieser Vorschrift ersatzfähig sind.
bb) Denn es fehlt selbst für die Schätzung einer Mindesthöhe der geforderten Entschädigung hinreichender Vortrag. Bei § 642 BGB handelt es sich um einen Vergütungsanspruch eigener Art für die fruchtlose Bereithaltung von Kapazitäten, der den Nachweis eines Schadens durch den Unternehmer nicht voraussetzt (Staudinger/Peters (2019) BGB § 642, Rn. 24). Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann. Anzusetzen ist dabei auf jeden Fall die volle Wartezeit als jene Zeit, für die Mitarbeiter, Maschinen und Materialien nicht gewinnbringend anderweitig eingesetzt werden können, weil sie für dieses Objekt zur Verfügung stehen mussten (Staudinger/Peters (2019) BGB § 642, Rn. 25). Das steht im Einklang damit, dass § 6 Abs. 3 S. 1 VOB/B die Pflicht vorsieht, die Weiterführung der Arbeiten zu ermöglichen und die Interessen des Auftraggebers zu schonen. Die Klägerin trägt vor, dass die Baustelle beräumt werden musste, um den eingesetzten Harvester kostenschonend anderweitig einzusetzen und ihn dann wieder zurückzubringen (Bl. 659 d.A.).
Nach diesen Maßstäben hat das Landgericht zutreffend entschieden, dass die Klägerin für eine Schätzung nach § 642 BGB unter entsprechender Heranziehung von § 287 ZPO nicht hinreichend vorgetragen hat. Die Klägerin hat in ihrem Nachtragsangebot für das Grundstück ### die Positionen “Baustelle einrichten” und “Baustelle räumen” kalkuliert und hierfür jeweils einen Betrag von 2.666,62 Euro angesetzt (K25 a Bl. 138, 143 d.A.). Allerdings heißt es hierzu im Nachtragsangebot lediglich, dass diese Positionen auf der Grundlage der Grundposition 02.00.001 [Baustelle einrichten] und der Grundposition 02.00.002 Baustelle räumen kalkuliert sei (Bl. 143 d.A.). Aus der dazu vorgelegten Nachtragskalkulation (K 26, Bl. 144 d.A.) wird allerdings ersichtlich, dass die Klägerin offenbar die Einkaufspreise aus der Vorkalkulation übernommen hat. Jedenfalls hat die Klägerin nicht erörtert, wie aus der Vorkalkulation zu Pos. 02.00.0001, die einen Betrag von 13.333,10 Euro (Bl. 113 d.A.) vorsieht, der Preis für den Nachtrag von 2.666,62 Euro der lediglich pauschal und ohne jede Aufgliederung geblieben ist, abgeleitet sein könnte. Zwar hat die Klägerin für den Nachtrag wohl 1/5 des für die gesamte Baustelleneinrichtung kalkulierten Betrags angesetzt (2.666,62 Euro x 5= 13.333,10 Euro). Da in der Vorkalkulation ein Mengensatz von 30 Stunden angesetzt ist, geht die Klägerin – geteilt durch 5 – wohl von einem Mengenansatz für den Nachtrag von 6 Stunden aus. Entsprechendes gilt für die Position “Baustelle räumen”.
Weshalb allerdings der für das vollständige Räumen und Wieder-Einrichten der Baustelle kalkulierte Mengenansatz von jeweils 30 Stunden aus der Vorkalkulation im Nachtrag für die Dauer von jeweils 6 Stunden für dem An- und Abtransport eines Harvesters kalkuliert worden ist und die Gemeinkosten von pauschal 3.699,70 Euro entsprechend der vorliegend genannten Stundenanzahl durch 5 geteilt und damit in Höhe von 739,94 Euro geltend gemacht worden sind, ist weder erläutert noch erschließt sich die Kalkulation im Übrigen. Insbesondere ist nicht ersichtlich, weshalb vorliegend für den Ab- und Antransport des Harvesters 6 Stunden im Verhältnis zu dem vollständigen Räumen bzw. Einrichten der Baustelle mit 30 Stunden angesetzt worden ist. Hierzu sind auch im Berufungsverfahren keine Erläuterungen erfolgt, obwohl schon das Landgericht aus den vorstehenden Gründen keine Entschädigung nach § 642 BGB zugesprochen hat. Allein durch den Hinweis im Nachtragsangebot, die dort pauschal angebotenen Positionen “Baustelle einrichten und räumen” seien auf der Grundposition “Baustelle einrichten und – räumen” des Hauptvertrags kalkuliert, wird ebenfalls nicht erkennbar, weshalb die Klägerin die vorstehenden Mengenansätze gewählt hat. Da anhand des Vortrags der Klägerin trotz des gerichtlichen Spielraums bei der Bestimmung der Entschädigung nach § 642 BGB eine solche vorliegend nicht bestimmbar ist, kann schließlich offenbleiben, ob die An- und Abtransportkosten vorliegend überhaupt ersatzfähig wären.
Ein Hinweis gemäß § 139 Abs. 2 S. 1 ZPO war nicht erforderlich, weil das Landgericht die Klage zu dieser Position mit einer vergleichbaren Argumentation abgewiesen und sich die Klägerin gleichwohl darauf beschränkt hat, mit der Berufungsbegründung wie aufgezeigt vorzutragen.
Die Einholung eines Sachverständigengutachtens war ebenfalls nicht erforderlich. Durch die Möglichkeit, ein Gutachten nach § 144 Abs. 1 S. 1 ZPO sogar von Amts wegen einzuholen, sind die Parteien nicht von ihrer Darlegungs- und Beweislast befreit. Der Parteivortrag muss konkrete Anknüpfungstatsachen bieten, die Grundlage für ein Gutachten sein können und die der Sachverständige beurteilen kann (BGH, Urteil vom 9. Dezember 2014 – X ZR 13/14 -, Rn. 34). Das ist, wie aufgezeigt, nicht der Fall.
b) Die Klägerin kann auch keinen Schadensersatz nach § 6 Abs. 6 S. 1 VOB/B verlangen. Nach dieser Vorschrift ist der Schaden zu ersetzen, der der Klägerin durch hindernde Umstände nachweislich entstanden ist und regelmäßig im Bereich des erforderlichen Mehraufwands bei der Erstellung der vertraglichen Leistung besteht (Döring, in Ingenstau/Korbion, VOB, § 6 Abs. 6 VOB/B, Rn. 26, 39). Hierfür ist nichts ersichtlich und wäre darüber hinaus nach den vorstehenden Ausführungen unter Gliederungspunkt a) ohnehin nicht hinreichend dargelegt.
c) Die Klägerin kann den Ersatz der durch die Bauverzögerung verursachten Mehrkosten auch nicht nach § 304 BGB erstattet verlangen. Soweit die Klägerin die Heranziehung dieser Norm durch das Landgericht rügt, bleibt das schon deshalb unerheblich, weil das Landgericht den Fall unter Berücksichtigung aller in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen zu prüfen hat. Hinzukommt, dass sich die Klägerin in erster Instanz ausdrücklich auch auf § 304 BGB gestützt hat (Bl. 686 d.A.).
Der Anspruch aus § 304 BGB wird durch § 642 BGB zwar nicht verdrängt (vgl. BGH, Urteil vom 21. Oktober 1999, VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32, 39 f.; Hartwig, BauR 2014, 1055, 1058 ff.; Roskosny/Bolz, BauR 2006, 1804, 1814). § 304 BGB gewährt jedoch lediglich den Ersatz von Mehraufwendungen, die für das erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstandes entstehen. Hierzu gehören nicht Mehrkosten, die der Unternehmer aufwenden muss, weil sich die Ausführung seiner Leistung aufgrund des Annahmeverzugs des Bestellers infolge Unterlassens einer ihm obliegenden Mitwirkungshandlung verzögert (vgl. BGH, Versäumnisurteil vom 26. Oktober 2017 – VII ZR 16/17 -, BGHZ 216, 319-332, Rn. 39; OLG Frankfurt, Urteil vom 3. Februar 2023 – 21 U 47/20 -).
4. Hinsichtlich des Grundstücks ### steht der Klägerin der geltend gemachte Anspruch ebenfalls unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu.
a) Dabei kann offen bleiben, ob die Anspruchsvoraussetzungen des § 642 BGB iVm § 6 Abs. 6 S. 2 VOB/B dem Grunde nach erfüllt sind. Denn es fehlt selbst für die Schätzung einer Mindesthöhe der geforderten Entschädigung hinreichender Vortrag.
Zwar trifft die Auffassung des Landgerichts vorliegend nicht zu, wonach der bloße schriftsätzliche Verweis auf Berechnungen in Anlagen zu Schriftsätzen den Vortragspflichten des Beklagten nicht genüge. Anlagen können zwar lediglich zur Erläuterung des schriftsätzlichen Vortrags dienen, diesen aber nicht vollständig ersetzen (BGH, Urteil vom 27. September 2001 – V ZB 29/01, BGH-Report 2002, 257; BGH, Urteil vom 2. Juli 2007 – II ZR 111/05 -; BGH, Urteil vom 2. Juli 2007 – II ZR 111/05, ZIP 2007, 1942 Rn. 25; Beschluss vom 11. April 2013 – VII ZR 44/12; BGH, Beschluss vom 23. September 2014 – II ZB 24/13 -, Rn. 12). Die Anlagen dienen allerdings vorliegend der Erläuterung schriftsätzlichen Vorbringens mit konkreter Inbezugnahme, es würde sich ersichtlich um eine bloße Förmelei handeln, die rechnerischen Angaben etwa aus der Nachtragskalkulation in den Schriftsatz mit aufzunehmen. Hinzu kommt, dass die Klägerin eben die Angaben der Nachtragskalkulation zuletzt noch einmal schriftsätzlich wiedergegeben hat.
Diese grundsätzlich ausreichende Bezugnahme auf die klägerseits vorgelegten Anlagen ändert gleichwohl nichts daran, dass dem Senat keine hinreichenden Schätzgrundlagen selbst für eine Mindestentschädigung zur Verfügung stehen. Zum Nachweis einer Verzögerungsentschädigung genügt es insbesondere nicht, die Verzögerung und die Stillstandszeit für Mannschaft und Gerät und die Vorhaltekosten darzustellen. Vielmehr muss konkret vorgetragen werden, welche Differenz sich bei einem Vergleich zwischen einem ungestörten und dem verzögerten Bauablauf ergibt (vgl. OLG Hamm, Urteil vom 12. Februar 2004 – 17 U 56/00 -; Rösch in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Aufl., § 642 BGB (Stand: 01.02.2023), Rn. 14). Macht ein Auftragnehmer einen Anspruch auf Entschädigung wegen Bauzeitverzögerung geltend, so kann für die Darlegung des nachweislich entstandenen Schadens bzw. der angemessenen Entschädigung eine konkrete bauablaufbezogene Darstellung erforderlich sein (vgl. Rösch in: Herberger/Martinek/Rüßmann/Weth/Würdinger, jurisPK-BGB, 10. Aufl., § 642 BGB (Stand: 01.02.2023), Rn. 13). Dafür muss der Anspruchsteller zunächst den bauvertraglich vereinbarten Bauablauf-, dann die genaue Behinderung- und schließlich deren konkrete Auswirkungen auf seine Leistungen darlegen (vgl. OLG München, Urteil vom 20. November 2007 – 9 U 2741/07 -; Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen BGH, Beschluss vom 9. Oktober 2008 – VII ZR 222/07 -).
Zwar ist ein detaillierter Vergleich zwischen dem vereinbarten und dem verzögerten Bauablauf vorliegend nicht erforderlich, da lediglich die Verzögerung von weiteren Baumfällarbeiten im Raum stand. Allerdings hat die Klägerin zum Beleg ihrer Entschädigung lediglich auf die Nachtragskalkulation (K 32 Bl. 184 d.A.) Bezug genommen. Dort ist auf der Grundlage des Nachtragsangebots (Bl. 183 d.A.) aufgeführt, dass Stillstandskosten zwischen 9.30 und 16.30 Uhr aufgetreten sind und angeführt, welche der Preise für die davon betroffenen Bagger, Rückezug, Hacker und LKW angesetzt worden sind.
Daher ist hier ebenso wie in Bezug auf das Grundstück ### (vorstehend unter Gliederungspunkt 4.) weder erläutert noch sonst erkennbar, wie die angesetzten Kosten auf der Grundlage der Vorkalkulation (etwa Bl. 122 d.A.) ermittelt worden sind, insbesondere welche Kosten der Stillstand der eingesetzten Gerätschaften verursacht hat. Die Klägerin hat – soweit ersichtlich – den Nachtrag auf der Grundlage der in der Vorkalkulation mehrfach ausgewiesenen Preise für Bagger, Rückezug, Hacker und LKW ermittelt und hat diese Preise dann in Bezug auf den Stillstandszeitraum – wohl abzüglich einer Mittagspause – mit 6 Stunden ermittelt. Daraus ist auch unter Anlegung großzügiger Maßstäbe nicht ermittelbar, ob und wie diese Preise den gegenständlichen Stillstand zutreffend abbilden.
b) Aus den unter Gliederungspunkt 3. aufgeführten Gründen steht der Klägerin auch kein Anspruch aus § 6 Abs. 6 S. 1 VOB/B bzw. § 304 BGB zu. Ein Hinweis war ebenso wenig wie die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich (vgl. oben unter Gliederungspunkt 3. a) aE).
5. Die Klägerin hat gegen die Beklagte unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt einen Anspruch auf Zahlung von weiteren 7.626,64 Euro über die bereits beglichenen 2.333,07 Euro hinaus für die Fällung von im Leistungsverzeichnis nicht vorgesehenen Bäumen mit einem Durchmesser von 0,5 bis 0,75 m. Dabei handelt es sich tatsächlich um eine im Vertrag nicht vorgesehene Leistung, die gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B eine gesonderte Vergütung erfordert. Die Erbringung der Leistung ist unstreitig (Bl. 545 d.A.). Die erforderliche Ankündigung ist mit Schreiben der Klägerin vom 15. Februar 2017 (K 33, Bl. 185 d.A.) erfolgt.
Die Frage, wie die Vergütung für Leistungen gemäß § 2 Abs. 6 Nr. 1 VOB/B erfolgt, ist umstritten. Einerseits wird vertreten, dass die Vergütung ausgehend des Kalkulationsgefüges des Hauptauftrags zu bestimmen ist (so etwa ausdrücklich Keldungs, in: Ingenstau/Korbion, § 2 Abs. 6 VOB/B, Rn. 30 ff.). Dagegen sieht die neuere Rechtsprechung im Hinblick auf § 650 c BGB die tatsächlich erforderlichen Kosten zuzüglich angemessener Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn als maßgeblich an (etwa OLG Brandenburg, Urteil vom 22. April 2020 – 11 U 153/18 -; OLG Frankfurt, Urteil vom 21. September 2020 – 29 U 171/19 -, unter Hinweis auf gleichlautende Rechtsprechung des BGH zu § 2 Nr. 3 VOB/B: Urteil vom 8. August 2019 – VII ZR 34/18 -, BGHZ 223, 45-57). Hierauf beruft sich die Klägerin und führt aus, dass sie ihre Vergütung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten ermittelt hat.
Es kann allerdings offenbleiben, welche der beiden Berechnungsmethoden anwendbar ist. Denn der Vortrag der Klägerin zu der geforderten Vergütung ermöglicht mangels greifbarer Anhaltspunkte keine Bestimmung einer zusätzlichen Vergütung. Dabei kann offenbleiben, ob es sich bei dem im Hauptauftrag zu negativen Einheitspreisen angesetzten Gutschriften für die dünneren Bäume von 140,00 Euro um kalkulatorische Nachlässe handelt, die auch bei Nachträgen zu gewähren sind (so OLG Brandenburg, Urteil vom 22. April 2020 – 11 U 153/18 -).
Unabhängig davon sind Gründe für einen höheren Einheitspreis nicht dargelegt. Denn das Landgericht hat zutreffend entschieden, dass zu berücksichtigen ist, dass die von der Klägerin angesetzten höheren Kosten daraus resultieren, dass die Klägerin bei den Kosten für den Bagger mit Spezialschere von Kosten von 345,60 Euro (K34, Bl. 503 d.A.) für die dickeren Bäume statt von 267,80 Euro (Anlage K22, Pos. 05.01.0007, Bl. 475 d.A.), für die dünneren Bäume ausgeht und einen Zeitaufwand pro Baum von 0,333 Stunden statt 0,05 Stunden ansetzt, im Übrigen haben sich die kalkulierten Kosten nicht geändert. Die Beklagte hat insbesondere trotz der darauf gestützten Klageabweisung nicht erläutert, warum die Fällung eines Baumes mit einem etwas größeren Umfang fast sieben Mal so lang dauert und warum der Bagger mit Spezialschere zwischen Angebotsabgabe 9. Januar 2017 und der etwa einen Monat später liegenden Fällung um 30% teurer geworden ist.
Eine erneute Hinweiserteilung war ebenso wenig wie die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich (vgl. oben unter Gliederungspunkt 3. a) aE).
6. Die mit Beschluss des Landgerichts vom 10. November 2022 zurückgewiesenen Berichtigungsanträge (Bl. 742 d.A.) führen ebenfalls nicht zum Erfolg der Berufung. Soweit das Landgericht eine sachliche Entscheidung über die Tatbestandsberichtigungsanträge deshalb abgelehnt hat, weil der erkennende Einzelrichter nicht mehr Mitglied der Kammer war, kann offenbleiben, ob die Entscheidung zu Recht erfolgt ist. Soweit es sich bei den gerügten Unrichtigkeiten um offenkundige Fehler handeln sollte, können sie zwar grundsätzlich auch durch das Berufungsgericht während des schwebenden Berufungsverfahrens berichtigt werden (BGH, Urteil vom 20. August 2009 – VII ZR 205/07 -, BGHZ 182, 158-187, Rn. 67; BGH, Beschluss vom 9. Februar 1989 – V ZB 25/88 -, BGHZ 106, 370-374, Rn. 13). Solche Fehler sind jedoch nicht ersichtlich, zumal die landgerichtlichen Feststellungen, die zum Gegenstand der Berichtigungsanträge gemacht worden sind, nicht entscheidungserheblich oder ohnehin der Entscheidung des Berufungsgerichts zu Grunde zu legen sind. Daher kann auch offenbleiben, ob die Klägerin gegen den Beschluss des Landgerichts vom 10. November 2022 nicht ohnehin im Wege teleologischer Reduktion von § 567 Abs. 1 Nr. 2 ZPO vorrangig sofortige Beschwerde hätte einlegen müssen (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 15. März 2004 – 24 W 8/04 -).
6. Die Klägerin macht darüber hinaus eine Vielzahl von Gehörsverletzungen, insbesondere von Verstößen gegen Hinweispflichten des Landgerichts geltend. Ob und welche Verstöße insoweit vorgelegen haben, kann aber offenbleiben. Zwar ist es nicht erforderlich, dass in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verfahrensrüge angeführt wird, welchen Vortrag der Rügende in Verkennung der Rechtslage angesichts der unterlassenen Hinweise des Gerichts unterlassen hat. Vielmehr reicht es aus, dass nach dem Inhalt der Berufungsbegründung ohne Zweifel ersichtlich ist, was aufgrund des gerichtlichen Hinweises vorgetragen worden wäre (BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 – I ZR 17/01 -). Das lässt sich vorliegend allenfalls mittelbar aus dem klägerischen Vortrag ableiten. Aber im Ergebnis kann ohnehin offenbleiben, ob eine relevante Gehörsverletzung vorliegt. Denn auch unter Berücksichtigung des gesamten Vortrags der Klägerin im Rechtsstreit hat die Klage keinen Erfolg.
7. Die Rechtsanwaltskosten sind mangels Berufungsangriffs nicht zum Gegenstand des Berufungsverfahrens gemacht.
8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO (vgl. Herget in: Zöller, Zivilprozessordnung, 34. Aufl. 2022, § 708 ZPO, Rn. 12).
9. Anlass für die Zulassung der Revision besteht nicht, weil die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO, und die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs nicht erfordern, § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO. Die Entscheidung beruht auf der Anwendung bereits höchstrichterlich geklärter Rechtsfragen im Einzelfall.
10. Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 47 Abs. 1, 48 Abs. 1 GKG.